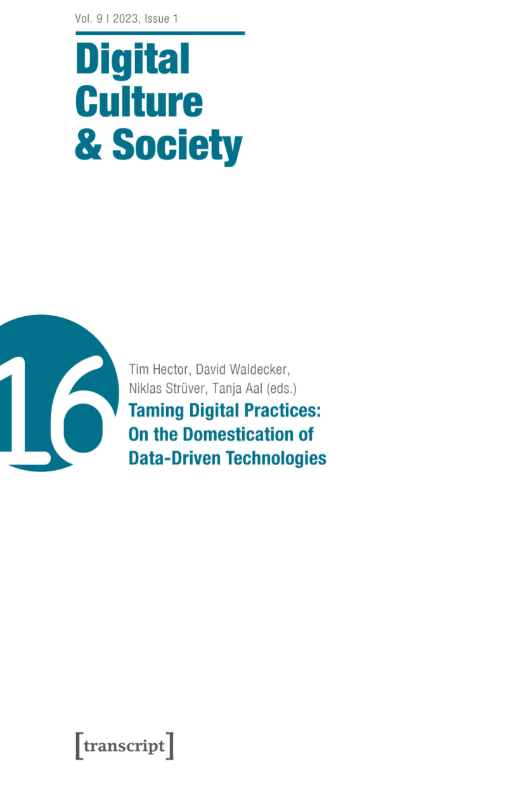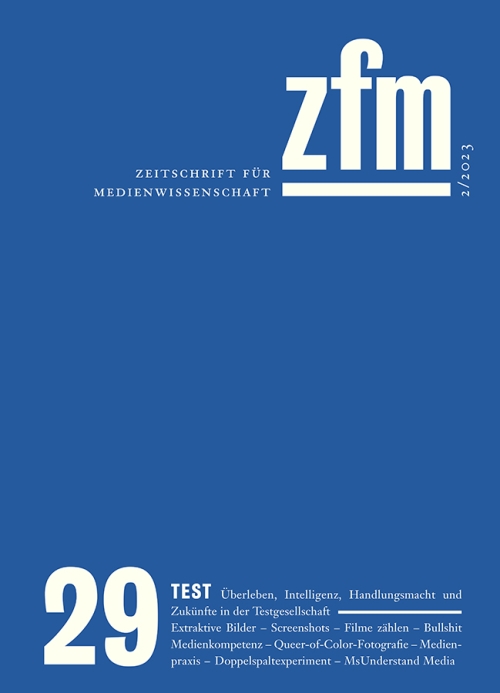Neuigkeiten
Machtdynamiken und Ungleichheiten in Wikipedia
Hannah Schmedes (Ruhr-Universität Bochum)
Im Juni 2024 hat unser SFB-Mitglied Hannah Schmedes (B09) in der Zeitschrift FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur 74 (2024) einen lesenswerten Artikel veröffentlicht mit dem Titel „–1.153 Characters. Towards A Queerfeminist Infrastructural Critique of Wikipedia“, in dem sie die versteckten Vorurteile, Machtdynamiken und Ungleichheiten innerhalb der Infrastruktur von Wikipedia untersucht.
Hannah Schmedes ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin und promoviert am Institut für Medienwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. Sie ist Mitarbeiterin des Teilprojekt „B09 – Fahrradmedien: Kooperative Medien der Mobilität“ im DFG-geförderten SFB 1187 „Medien der Kooperation“
FKW // Zeitschrift für Geschlechterforschung und visuelle Kultur analysiert visuelle Repräsentationen und Diskurse in ihrer gesellschaftlichen und geschlechterpolitischen Bedeutung. So verbindet FKW kunst- und kulturtheoretische, bild- und medienwissenschaftliche, genderspezifische, politische und methodische Fragestellungen zu einer kritischen Kulturgeschichte des Visuellen. Fragen nach Konstruktionen im Feld der visuellen Kultur, nach Ein- und Ausschlussmechanismen, symptomatischen Subjektentwürfen wie unreflektierten Objektivierungen stehen im Vordergrund des repräsentationskritischen Interesses. Aus einer Perspektive heraus, die Wissen und Verstehen als dynamische, immer auch in Veränderung befindliche Prozesse begreift, sieht sich FKW als eine Plattform für konstruktive Auseinandersetzung und Diskussion, die dazu Denkanstöße geben und Wege des Umdenkens kritisch begleiten will.
Convergence 30 (1) Special Issue on „Critical Technical Practice(s) in Digital Research“
Daniela van Geenen (Universität Siegen)
Karin van Es (Universität Utrecht)
Jonathan Gray (King’s College London)
Unser SFB-Mitglied Daniela van Geenen (A03) hat zusammen mit Karin van Es und Jonathan Gray die Sonderausgabe „Critical Technical Practice(s) in Digital Research“ herausgegeben, die nun in der Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 30 (1) erschienen ist.
Save the date: Die Herausgeber*innen werden die Sonderausgabe ihm Rahmen des SFB-Forschungsforum am 10 Juli von 14-16 Uhr CEST mit einigen Kurzvorträgen vorstellen. Sie können entweder Online oder in Siegen an der Veranstaltung teilnehmen! Kontakt: Daniela van Geenen.
Links zu den Artikeln und der Sammlung der lebenden Literatur (Zotero-Gruppe) sind hier zu finden.
In diesem Sonderheft befassen sich die Autoren mit Ideen und Ansätzen kritischer technischer Praktiken (CTPs) als Ansatzpunkte für Kritik und kritisches Handeln in digital vermittelten Kulturen und Gesellschaften. Sie untersuchen die Pluralisierung der „kritischen technischen Praxis“, angefangen von ihren frühen Formulierungen im Kontext der KI-Forschung und -Entwicklung (Agre, 1997a, 1997b) bis hin zu den vielen Wegen, auf denen sie in verschiedenen Publikationen, Projekten, Gruppen und Praxisgemeinschaften Resonanz gefunden hat und aufgegriffen wurde, und was sie mittlerweile bedeutet. Agre definiert CTP als eine situative, praktische und konstruktive Arbeitsweise: „eine technische Praxis, bei der die kritische Reflexion über die Praxis Teil der Praxis selbst ist“ (1997a: XII). Die Praxisgemeinschaften, in denen der Begriff übernommen, angepasst und angewandt wurde, reichen von der Mensch-Computer-Interaktion (HCI) bis zur Medienkunst und Pädagogik, von den Wissenschafts- und Technologiestudien (STS) und der computergestützten kooperativen Arbeit (CSCW) bis zu den digitalen Geisteswissenschaften, den Medienwissenschaften und den Datenstudien. Diese Sonderausgabe ist eine Einladung, (neu) zu überlegen, was es bedeutet, diesen Begriff zu verwenden, indem man sich auf ein breiteres Spektrum von Arbeiten stützt, auch über Agre hinaus. In dieser Einleitung werden CTPs nach (1) Agre, (2) indizierter Forschung und (3) Beiträgen zu diesem Sonderheft untersucht und diskutiert. Sie schließen mit einigen Fragen und Überlegungen für diejenigen, die an der Arbeit mit diesem Begriff interessiert sind.
Die Ausgabe ist gleichzeitig zeitgemäß und zeitlos und enthält Beiträge von Tatjana Seitz (A01) & Sam Hind; Michael Dieter; Jean-Marie John-Mathews, Robin De Mourat, Donato Ricci und Maxime Crépel; Anders Koed Madsen; Winnie Soon und Pablo Velasco; Mathieu Jacomy und Anders Munk; Jessica Ogden, Edward Summers und Shawn Walker; Urszula Pawlicka-Deger; Simon Hirsbrunner, Michael Tebbe und Claudia Müller-Birn; Bernhard Rieder, Eric Borra und Stijn Peters; Carolin Gerlitz (A03 & Sprecherin des SFB 1187), Fernando van der Vlist und Jason Chao; Daniel Chavez Heras; und Sabine Niederer und Natalia Sanchez Querubin.
Daniela van Geenen ist Dozentin für Datenjournalismus und Visualisierung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Utrecht und Doktorandin am DFG SFB 1187 „Medien der Kooperation“ und Mitglied des Projekts “A03 – Navigation in Online/Offline Räumen” an der Universität Siegen. Karin van Es ist außerordentliche Professorin für Medien- und Kulturwissenschaften und Projektleiterin für Geisteswissenschaften an der Data School der Universität Utrecht. Jonathan Gray ist Dozent für Critical Infrastructure Studies am Department of Digital Humanities, King’s College London.
Convergence ist eine internationale wissenschaftliche Zeitschrift mit Peer-Review, die 1995 gegründet wurde, um sich mit den kreativen, sozialen, politischen und pädagogischen Fragen zu befassen, die durch das Aufkommen der neuen Medientechnologien aufgeworfen wurden. Als internationale Forschungszeitschrift bietet sie ein Forum für die Beobachtung und Erforschung von Entwicklungen in diesem Bereich und für die Anregung, Veröffentlichung und Förderung wichtiger innovativer Forschung. Convergence verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und erscheint sechsmal im Jahr. Dadurch hat sich dieser Bereich zu einem völlig neuen Forschungsfeld entwickelt.
In der neusten Publikation “Kontrapunkte setzen – Digitale Politische Bildung mit ContraPoints” in unserer Working Paper Series (No. 35, Dez) setzt sich Julia Bee mit den Potenzialen kreativer Format Politischer Bildung in digitalen Kontexten auseinander. Im Zentrum stehen videoessayistische Gegenformaten von Stiftungen, Institutionen und Vlogger:innen, die darauf abzielen, rechte Metapolitiken zu entlarven und zu erkennen. Sie produzieren Bildungsformate, die nicht nur inhaltlich und informativ, sondern auch ästhetisch und affektiv anknüpfen.
Stiftungen, Institutionen und Vlogger:innen haben in den letzten Jahren angesichts des Rechtsrucks auf Plattformen neue Formate der Politischen Bildung geschaffen. Diese wollen präventiv und intervenierend in rechte Diskurse, Trolling, Fake News und Co. eingreifen. Am Beispiel des Youtube-Kanals ContraPoints untersucht Bee die Formatspezifik der politischen Bildung, die im Anschluss an Donna Haraway als situiertes Wissen verstanden wird.
Julia Bee ist Professorin für Medienästhetik an der Universität Siegen. In ihrer Forschung kombiniert sie ästhetische Phänomene mit Medienphilosophie und Praxistheorie. Dekoloniale und Gender Medien Theorie sind dabei zentral. Derzeitige Forschungsgegenstände bilden dokumentarische Filme, TV-Serien, Vlogs, Installationen, Literatur sowie mobile Medienpraktiken wie Fahrradfahren. Sie ist Teilprojektleiterin des ab Januar 2024 neu geförderten Projekts B09 Fahrradmedien: Kooperative Medien der Mobilität.
Die Publikation „Kontrapunkte setzen – Digitale Politische Bildung mit ContraPoints” wird im Rahmen der Working Paper Series des SFB 1187 „Medien der Kooperation“ veröffentlicht. Die Working Paper Serie versammelt aktuelle Beiträge aus dem Umfeld der inter- und transdisziplinären Medienforschung und bietet die Möglichkeit einer schnellen Veröffentlichung und ersten Verbreitung von am SFB laufenden oder ihm nahestehenden Forschungsarbeiten. Ziel der Reihe ist es, die SFB-Forschung einer breiteren Forschungsgemeinschaft zugänglich zu machen. Alle Working Papers sind über die Website zugänglich oder können in gedruckter Form bei info[æt]sfb1187.uni-siegen.de bestellt werden.
In der neusten Publikation “Co-Teaching Post-digital Ethnography” in unserer Working Paper Series (No. 34, Okt) beschäftigen sich Simone Pfeifer und Suzana Jovicic mit der Vermittlung komplexer Theorien und methodologischer Ansätze. Reflektiert wird über die Co-Teaching-Methoden, welche in einer Masterclass über postdigitale Ethnografien. Ziel dieser Arbeit ist es außerdem, Beispiele für die Umsetzung in Lehr- und Co-Teaching-Konstellationen anhand von Lehrübungen zu präsentieren.
Simone Pfeifer ist Sozial- und Kulturanthropologin mit einem Fokus auf Visuelle Anthropologie, Digitale- und Medienethnologie. Sie arbeitet als Postdoktorandin im Graduiertenkolleg und fokussiert in ihrem Forschungsprojekt auf muslimischen Alltag und digitale Medienpraktiken in Deutschland. Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ethnologie und Afrikastudien der JGU Mainz im Forschungsprojekt „Dschihadismus im Internet: Die Gestaltung von Bildern und Videos, ihre Aneignung und Verbreitung“ und am Graduiertenkolleg „Locating Media“ der Universität Siegen.
Suzana Jovicic ist Postdoc-Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und Dozentin am Institut für Sozial- und Kulturanthropologie der Universität Wien. Sie ist Co-PI des interdisziplinären Projekts „We-Design“, das ethnografische Forschung über die Rolle digitaler Technologien in Bezug auf den Zugang zu Arbeit unter Wiener Jugendlichen mit partizipativem Design und App-Entwicklung verbindet. Ihre Interessen liegen in den Bereichen digitale, Design- und psychologische Anthropologie, Jugendliche und partizipative Forschung. Sie ist Mitbegründerin der Digital Ethnography Initiative (DEI) an der Universität Wien.
Die Publikation „Co-Teaching Post-digital Ethnography” wird im Rahmen der Working Paper Series des SFB 1187 „Medien der Kooperation“ veröffentlicht. Die Working Paper Serie versammelt aktuelle Beiträge aus dem Umfeld der inter- und transdisziplinären Medienforschung und bietet die Möglichkeit einer schnellen Veröffentlichung und ersten Verbreitung von am SFB laufenden oder ihm nahestehenden Forschungsarbeiten. Ziel der Reihe ist es, die SFB-Forschung einer breiteren Forschungsgemeinschaft zugänglich zu machen. Alle Working Papers sind über die Website zugänglich oder können in gedruckter Form bei info[æt]sfb1187.uni-siegen.de bestellt werden.
Ob Hund, Katze, Smart Speaker, alle drei brauchen einige Zeit um richtig im Haushalt anzukommen. In vielen Lebensbereichen durchziehen datengesteuerte und vernetzte Technologien den Alltag: So sollen u.a. Staubsaugerroboter, Smart Speaker, Drohnen oder Küchengeräte das Leben verbessern. Indem der Mensch diese Technologien in einem Prozess der Domestizierung in sein Leben integriert, zähmt er sie einerseits und wird andererseits durch sie beeinflusst.
Das Themenheft„Taming Digital Practices. On the Domestication of Data-Driven Technologies“ von Digital Culture & Society kombiniert Domestizierungsforschung mit Analysen aktueller, digitaler und vernetzter Medien und untersucht so den Prozess der Zähmung digital vernetzter Medien mit dem Schwerpunkt auf Praktiken. Dabei bündelt das Heft interdisziplinäre Perspektiven, u.a. aus der Medienwissenschaft, der Soziologie, der Anthropologie und der Human-Computer-Interaction, darunter eine Reihe von Beiträgen aus dem SFB Medien der Kooperation.
Herausgegeben von Tim Hector, David Waldecker, Niklas Strüver vom Teilprojekt B06 „Un/erbetene Beobachtung in Interaktion: „Intelligente Persönliche Assistenten“ (IPA)“ und Tanja Aal vom Teilprojekt A05 „Kooperative Herstellung von Nutzerautonomie im Kontext der alternden Gesellschaft“.
In der neusten Publikation „Unboxing Spain’s Colonial Past in the Rif – Situating memory work and transborder publics in a Domestic Basement Archive in Madrid” unser Working Paper Series analysiert Carla Tiefenbacher die archivarischen Praktiken der Bewohner der nordmarokkanischen Stadt Al Hoceima. Unter Berücksichtigung des laufenden transmediterranen und spanischen Erinnerungsaktivismus untersucht die Autorin die Funktionsweise und Reoression des Kolonialismus in Spanien und Nordmarokko und arbeitet mithilfe der über mehrere Machtwechsel gesammelten Erfahrungen der Bewohner und der aufbewahrten Objekte eine Sammlungspraxis heraus.
Im Rahmen des Teilprojekts „Digitale Öffentlichkeiten und soziale Transformationen im Maghreb“ stellt Carla Tiefenbacher derzeit ihre Magisterarbeit über Archivierungspraktiken und Erinnerungsinfrastrukturen in den letzten spanischen Kolonialmächten in Nordmarokko fertig. Sie besitzt einen B.A. in Liberal Arts and Sciences von der Universität Freiburg und absolviert aktuel den interdisziplinären Studiengang „Kultur und Umwelt in Afrika“ an der Universität zu Köln. Sie ist zudem ausgebildete Mediatorin und Trauerbegleiterin.
Die Publikation „Unboxing Spain’s Colonial Past in the Rif – Situating memory work and transborder publics in a Domestic Basement Archive in Madrid“ wird im Rahmen der Working Paper Series des SFB 1187 „Medien der Kooperation“ veröffentlicht. Die Working Paper Serie versammelt aktuelle Beiträge aus dem Umfeld der inter- und transdisziplinären Medienforschung und bietet die Möglichkeit einer schnellen Veröffentlichung und ersten Verbreitung von am SFB laufenden oder ihm nahestehenden Forschungsarbeiten. Ziel der Reihe ist es, die SFB-Forschung einer breiteren Forschungsgemeinschaft zugänglich zu machen. Alle Working Papers sind über die Website zugänglich oder können in gedruckter Form bei info[æt]sfb1187.uni-siegen.de bestellt werden.
Carolin Gerlitz, Sprecherin des SFB und Teilprojektleiterin von A03, P03 und MGK, und Sebastian Gießmann, Teilprojektleiter von A01, zeichnen für das aktuelle Heft der Zeitschrift für Medienwissenschaft zum Thema TEST verantwortlich. Sie fragen, wie sich Medien und Tests wechselseitig konstituieren. Besondere Aufmerksamkeit erfahren dabei Politiken des Testens. Gerlitz und Gießmann schlagen vor, Tests als offene Situationen zu verstehen, in denen mit teils etablierten, teils sich erst während des Testens etablierenden Maßstäben soziotechnische Bewertungen erfolgen und Entscheidungen getroffen werden. Für einen medienkulturwissenschaftlichen Begriff des Tests gilt: In den Mikroentscheidungen des verteilten und verteilenden Testens steht das Soziale selbst auf der Probe. Die in diesem Heft versammelten Beiträge verdeutlichen: kein Test ohne Medien – kein Medium ohne Test.
Mit Beiträgen von David Bucheli, Gabriele Schabacher, Sophie Spallinger, Stefan Rieger, Daniela Holzer, Christoph Borbach, Noortje Marres und Philippe Sormani.
Das Heft erscheint im Open Acess.
Konzeption und Beiträge werden am Mittwoch, den 29. November im Rahmen des SFB Forschungsforums vorgestellt.
Die neue dreiteilige Publikationsreihe „Defining Digitalities I – III“ in der Working Paper Series von Thomas Haigh und Sebastian Gießmann fragt „What’s Digital about Digits?“ (Nr. 30, Juli 2023), „What’s Digital About Digital Communication?“ (Nr. 31, Juli 2023) und „What’s Digital About Digital Media?“ (Nr. 32, Juli 2023). Bei der Beantwortung dieser Fragen konzentriert sich die Kurzserie darauf, zu definieren, was Digitalität ist, indem sie sich dem Thema historisch nähert und die damit verbundenen Lese- und Schreibpraktiken analysiert.
Im ersten Beitrag „What’s Digital about Digits?“ von Thomas Haigh wird argumentiert, dass Digitalität nicht ein Merkmal eines Objekts selbst ist, sondern die Art und Weise, wie dieses Objekt (ob von Menschen oder Maschinen) als Kodierung von Symbolen aus einer endlichen Menge gelesen wird. Thomas Haigh kommt dann zu dem Schluss, dass Digitalität durch Lesepraktiken konstituiert wird.
Nr. 31 und Nr. 32 wurden von Thomas Haigh und Sebastian Gießmann geschrieben. In „What’s Digital About Digital Communication?“ setzen sie ihre Arbeit zu Medien- und Kommunikationssystemen fort, indem sie die historische Ausweitung des Digitalitätsbegriffs auf nicht-numerische Repräsentationssysteme, wie sie zur Codierung von Texten und Bildern verwendet werden, untersuchen.
Darüber hinaus diskutiert das dritte Papier „What’s Digital About Digital Media?“ Digitalität als Merkmal der Praktiken, die zum Lesen und Schreiben von Symbolen von einem Medium verwendet werden, und nicht als physische Eigenschaft des Mediums selbst, und untersucht die begrenzte Austauschbarkeit von Repräsentationen zwischen verschiedenen Kodierungen derselben Symbole, indem es die vermeintliche Immaterialität der Digitalität mit dieser tatsächlichen Fungibilität materieller Repräsentationen verbindet.
Dr. Sebastian Gießmann ist Leiter des SFB-Teilprojekts A01 „Digitale Netzwerktechnologien zwischen Spezialisierung und Generalisierung“, Ph. D. Thomas Haigh assoziierter Forscher des selben Teilprojekts.
Die Kurzserie zum Thema „Defining Digitalities“ ist eine Vorveröffentlichung ihres bald erscheinenden, gleichnamigen Buchs und wird im Rahmen der Working Paper Series des SFB 1187 veröffentlicht, die die inter- und transdisziplinäre Medienforschung fördert und einen Weg für die schnelle Veröffentlichung und Verbreitung laufender Forschungsarbeiten am SFB oder in Verbindung mit dem SFB bietet. Ziel der Reihe ist es, laufende Forschungsarbeiten über den SFB hinaus an eine breitere Forschungsgemeinschaft weiterzugeben. Alle Arbeitspapiere sind über die Website zugänglich oder können in gedruckter Form per E-Mail bestellt werden unter: info[æt]sfb1187.uni-siegen.de
The new publication “‚Anything can happen on a smartphone…‘ – Mutual explorations of digitalization and social transformation in Morocco’s High Atlas through On/Offline Theatre Ethnography” by Nina ter Laan in collaboration with Marike Mahtat-Minnema discusses the use of (online) theatre as an ethnographic research tool. Drawing from an existing collaborative study, they discuss (digital) media use and social transformation in a Moroccan village situated in the High Atlas Mountains of Morocco. Their project constitutes as a solution for the challenges imposed by Covid restrictions. The working paper describes the process, motivations, design, and outcomes of the project, as well as the controversies, opportunities, and struggles that arose during the theatre work.
Nina ter Laan is postdoctoral researcher within the research project B04 Digital Publics and Social Transformation in the Maghreb, working at the University of Cologne. Her research centers on aesthetic practices, religion, materiality, and heritage production, in conversation with politics of belonging, with a particular focus on Morocco. She is interested in the exploration of art forms as a subject and a method of research.
The paper »‚Anything can happen on a smartphone…‘« is published as part of the Working Paper Series of the CRC 1187, which promotes inter- and transdisciplinary media research and provides an avenue for rapid publication and dissemination of ongoing research located at or associated with the CRC. The purpose of the series is to circulate in-progress research to the wider research community beyond the CRC. All Working Papers are accessible via the website or can be ordered in print by sending an email to: info[æt]sfb1187.uni-siegen.de.
Die neue Publikation der Working Paper Series (Nr. 28, Juni 2023) „Testing ‘AI’: Do We Have a Situation?“ von Noortje Marres und Philippe Sormani basiert auf dem Transkript eines Gesprächs, das die Autor*innen über das Testen Künstlicher Intelligenz in der Praxis und die „Situationen“, die KI mit sich bring, geführt haben. Das Gespräch fand am 25. Mai 2022 im Rahmen der Ringvorlesung „Testign Infrastructures“ des Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ statt.
In ihrem Gespräch diskutieren Marres und Sormani die gesellschaftlichen Auswirkungen Künstlicher Intelligenz anhand von drei Fragen: Zunächst widmen sie sich der klassischen Kritik an KI seitens der Soziologie und Anthropologie; anschließend stellen sie sozialwissenschaftliche Studien zu Technologien, die KI in der Praxis testen, zur Diskussion; zuletzt setzen sie sich mit „Definitionen von Situationen“ und den einhergehenden Spannungen und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Fachdisziplinen auseinander. Zusätzlich zu Marres und Sormanis Diskussion ist im Working Paper auch die anschließende Diskussion mit den Teilnehmenden des Forums abgedruckt.
Noortje Marres ist Professorin an der University of Warwick. Sie forscht zur digitalen Methoden, der Technologisierung von Gesellschaft, der Rolle von Objekten und alltäglichen Umgebungen sowie die sich wandelnde Beziehung zwischen Sozialwissenschaft und sozialem Leben im digitalen Zeitalter. Ihre Arbeiten tragen zu einem interdisziplinären Verständnis von Wissenschaft, Technologie und Gesellschaft bei. Philippe Sormani ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Teilprojekt P01 – Medien der Praxeologie I: Die „Discovery Procedures“ der Science and Technology Studies. Seine Forschung verortet sich im bereich der Ethnomethodologie und Konversationsanalyse.
Die Publikation „Testing ‘AI’: Do We Have a Situation?“ wird im Rahmen der Working Paper Series des SFB 1187 „Medien der Kooperation“ veröffentlicht. Die Working Paper Serie versammelt aktuelle Beiträge aus dem Umfeld der inter- und transdisziplinären Medienforschung und bietet die Möglichkeit einer schnellen Veröffentlichung und ersten Verbreitung von am SFB laufenden oder ihm nahestehenden Forschungsarbeiten. Ziel der Reihe ist es, die SFB-Forschung einer breiteren Forschungsgemeinschaft zugänglich zu machen. Alle Working Papers sind über die Website zugänglich oder können in gedruckter Form bei info[æt]sfb1187.uni-marburg.de bestellt werden.
2 / 4