A04 - Normale Betriebsausfälle. Struktur und Wandel von Infrastrukturen im öffentlichen Dienst
Teilprojektleitung:
Assoziierte Mitarbeiterin:
Wissenschaftliche Hilfskräfte:
Anna Boysen Carnicé
Mitarbeitende:
Ehemalige Mitarbeitende:
„Das Projekt erkundet, ob mediale Darstellungen technische Störungen im Schienen- und im Straßenverkehr zugunsten der Straße und damit zu Lasten des Klimas normalisieren. Es erarbeitet einen praxeologisch inspirierten Vorschlag, zeitgenössische Mobilitätskrisen in ihrer multiplen Realität zu dokumentieren.“
Zusammenfassung
Disruption und Normalisierung stehen in einem bemerkenswert stabilen Zusammenhang (Wynne 1988; Potthast 2021). Zugleich sind die Muster eines normalisierenden Umgangs mit technischen Störungen, etwa im Hinblick auf ihre Zeitstruktur, durchaus vielfältig. Um diese eher mikroanalytischen Befunde der ersten und zweiten Laufzeit einem makrohistorischen Diskussionszusammenhang zuzuführen, knüpft das Teilprojekt in der dritten Laufzeit an Forschungen über ‚Große Technische Systeme‘ (GTS) an. Diese Forschungen werden oft herangezogen, um auf den irreduzibel sozio-technischen Charakter infrastrukturell bereitgestellter Leistungen aufmerksam zu machen. Eine grundlegende historiographische Ambition dieses Forschungsansatzes wird jedoch vernachlässigt: Die Entwicklung von Infrastrukturen lasse sich maßgeblich auf ein dynamisches Zusammenspiel von ‚Größe‘ und ‚Systemizität‘ zurückführen. Welche Rolle dabei Mustern der Normalisierung zukommt, soll im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung zu einer Klärung beitragen, warum eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene so hartnäckig ausbleibt. Für den Vergleich bezieht das bisher auf öffentliche Verkehrsmittel beschränkte Projekt daher auch den motorisierten Individualverkehr mit ein. Verhilft die komparative Betrachtung zu neuen Aufschlüssen darüber, warum eine Verkehrswende hin zu einem weniger klimaschädlichen Modal split so hartnäckig ausbleibt? Welchen Anteil haben Muster der Normalisierung an diesen Beharrungskräften?
Historisch und territorial begrenzt auf Deutschland zwischen 1990 und 2023 wird das Teilprojekt die These verfolgen, dass in der Entwicklung der Schiene ein Umgang mit Störungen dominiert, der vorwiegend in systemische Aufwärtstransformation mündet. Im Kontrast dazu kann in der Entwicklung des Straßenverkehrs ein variabler Umgang mit Störungen erkannt werden, der vorwiegend seiner Größe (dem Momentum) förderlich ist, sich aber nicht in einer systemisch gesteigerten Selbstbeobachtung niederschlägt. Um diese These zu erhärten, rekonstruiert das Teilprojekt, wie die Tagespresse im genannten Zeitraum über Mobilitätskrisen berichtet. Als Mobilitätskrise gilt dabei, wenn zwei oder mehr der folgenden Mobilitätspraktiken durcheinandergeraten: Wohnsitzwechsel (gewählt, erzwungen), Fernreisen (beruflich, touristisch), beruflich bedingte Alltagsmobilität (Pendeln), alltägliche Freizeit- und Versorgungsmobilität. Maßgeblich für diese Analyse ist, wie bezogen auf die relevanten Threads Muster der Normalisierung greifen.
Das Teilprojekt erarbeitet eine vergleichende Fallstudie zur Entwicklung von GTS und offeriert über die Multiplizität der Störung und die Muster ihrer Normalisierung einen Vorschlag zur praxeologischen Neuausrichtung der GTS-Forschung. Im Rahmen des SFB entwickelt es einen historisch konturierten Beitrag zur Frage der Skalierbarkeit von Kooperation und setzt durch die praxeologische Perspektive auf die GTS-Forschung neue Impulse für die Kontroversenanalyse. Die Rekategorisierung von Mobilitätskrisen muss sich gegenüber einer etablierten Routine (Kosten-Nutzen-Kalkulation) beweisen und im Zuge eines schrittweise validierten Berichtsformats (für Disruptionen und ihre Normalisierung) praktisch bewähren.
Potthast, J. 2021. „Innovation und Katastrophe“. In Handbuch Innovationsforschung, herausgegeben von B.Blättel-Mink, I. Schulz-Schaeffer und A. Windeler, 363-380. Wiesbaden: Springer VS.
Wynne, B. 1988. „Unruly technology: Practical rules, impractical discourses and public understanding“. Social Studies of Science 18 (1): 147-167.
Große Technische Systeme (GTS) sind durch den russischen Angriffskrieg mit Wucht auf die politische und mediale Agenda zurückgekehrt. Mit einer zugleich stärker komparativen und konsequent praxeologischen Ausrichtung interveniert das Projekt, gestützt auf Befunde zum verteilten Umgang mit Störungen (2016-2023), in den nach GTS benannten interdisziplinären Forschungszusammenhang.
- Das Projekt ermittelt, wie (lange) Störungen im Schienen- und im Straßenverkehr den Normalitätssinn strapazieren.
- Es entwickelt es ein Berichtsformat für multiple Verkehrs-träger übergreifende Störungen.
- Anhand einer regionalen Mobilitätskrise erprobt es, ob sich dieses Berichtsformat als Medium der Kooperation bewährt.
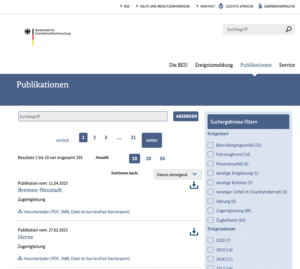
(© Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung)
Das Projekt arbeitet methodenplural:
- Es stellt aus großen Beständen an Störungsmeldungen Threads zusammen und unterzieht diese einer sequentiell und aktantiell vergleichenden Analyse.
- Es unterzieht die vorgefundenen Berichtsformate einer praxeologischen Revision.
- Es führt dieses Berichtsformat im Zuge der Dokumentation einer regionalen Mobilitätskrise einem Pilotversuch zu.
| 9-Euro-Ticket überlastet hunderte Züge | 07.06.2022 | dpa u.a. |
| Auf dem Land ist das 9-Euro-Ticket eher unbeliebt | 10.06.2022 | dpa u.a. |
| Ein Nachfolger für das 9-Euro-Ticket | 12.06.2022 | Dyrk Scherff |
| 9-Euro-Ticket ist ein Erfolg | 14.06.2022 | AFP |
| Verlängerung des 9-Euro-Tickets ausgeschlossen | 23.06.2022 | Rahel Gloub |
| 21 Millionen 9-Euro-Tickets im Juni verkauft | 30.06.2022 | dpa |
| So begehrt ist das 9-Euro-Ticket | 07.07.2022 | Reuters |
| 9-Euro-Ticket sorgt für leere Sitzplätze in den Flixbussen | 08.07.2022 | Henning Peitsmeier |
| Was nach dem 9-Euro-Ticket kommt | 12.07.2022 | Corinna Budras |
| „Das 9-Euro-Ticket macht krank“ | 16.07.2022 | Sebastian Reuter u.a. |
| 9-Euro-Ticket als Testfahrkarte | 19.07.2022 | Ralf Euler |
Drei Schwerpunkte kennzeichnen den Fortgang der Untersuchung:
- Eine Verlaufsanalyse gibt darüber Aufschluss, wie Störungen als Medienereignis einer Normalisierung zugeführt werden — und wie sich darüber Unterschiede in Größe und Systemarchitektur zwischen Schienen- und Straßenverkehr verfestigen.
- Gegenläufig dazu erfolgt eine Forminvestition in ein beide Verkehrsträger übergreifendes Berichtsformat.
- Inwiefern das revidierte Berichtsformat Aufschluss über verschränkte Mobilitätskrisen bietet, wird abschließend im Zuge einer ortssensiblen
Untersuchung reflektiert.


➔ Hier geht es zum Projektarchiv 2020–2023
Publikationen
Neu erschienen: Röhl, Tobias. 2023. When to Care: Temporal Displacements and the Expertise of Maintenance Workers in Public Transport. Engaging Science, Technology, and Society 9 (3): 84-99. https://doi.org/10.17351/ests2023.1351.
Abstract:
Fueled by digital developments modern wage labor is increasingly subject to new forms of temporal objectification. In the field of public transport, maintenance workers must deal with two recent developments. Predictive maintenance and the digital tracking of time temporally displace maintenance and repair work. When dealing with disruptions, such systems favor anticipatory measures and retrospective evaluation over work practices in the immediate aftermath. This challenges the professional expertise of workers and limits their ability of caring for the infrastructure on their own terms. While this limits the scope of practical knowledge in dealing directly with disruptions, it also opens up new avenues for autonomy and creates opportunities for reevaluing practical knowledge in other areas. The ability to improvise is increasingly important given that the systems are often unreliable and operate on the basis of vague assumptions. Instead of a de-skilling, a temporal shift occurs. Practical knowledge becomes important beyond immediate repair practices, namely before and after disruptions are dealt with.
Störungen des öffentlichen Verkehrs sind nervenaufreibend. Doch wo beschwert man sich, wenn der Zug ausfällt? Beim Personal vor Ort oder gleich beim Unternehmen? Der ethnographische Blick ins Störungsmanagement der Verkehrsbetriebe zeigt: Jeweils für sich genommen ist keine der beiden Strategien hilfreich. Mit Rückgriff auf Forschungen zu Accountability und technischen Infrastrukturen zeichnet die organisations-ethnographische Studie nach, wie Fragen der Verantwortlichkeit technisch vermittelt und zwischen verschiedenen Akteuren hin- und hergeschoben werden. Diese »verteilte Zurechenbarkeit« lässt sich nicht in einzelnen Individuen verorten, sondern findet sich im Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure, in den Prozessen und Praktiken des Störungsmanagements.
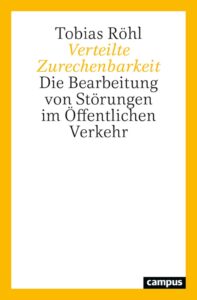
Tobias Röhl, 2022. Verteilte Zurechenbarkeit. Die Bearbeitung von Störungen im Öffentlichen Verkehr. Frankfurt; New York: Campus. ISBN: 9783593515298. https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wissenschaft/soziologie/verteilte_zurechenbarkeit-17097.html.
FAZ Interview von Uwe Ebbinghaus mit Tobias Röhl (01.08.2022) "Wir bitten, dies zu entschuldigen..."
zum Artikel
WDR 5 Interview von Thomas Koch mit Tobias Röhl (29.08.2022) "Die Entschuldigungen der Deutschen Bahn"
zum Beitrag


