Neuigkeiten
Teppiche als Medien des Geschichtenerzählens
von Tahereh Aboofazeli und Arjang Omrani
Der SFB 1187 „Medien der Kooperation“ lädt herzlich zur Ausstellung WE ARE NOT CARPETS: I tell you my story, die vom 6. bis 31. Oktober 2025 im Poool Kunstraum, Siegen zu sehen ist. Fünf Kunstweber*innen aus der Region Nord-Khorasan im Iran nehmen mit acht lebensgroßen Teppichen an der Ausstellung teil und erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten.
Über die Ausstellung
Die Ausstellung WE ARE NOT CARPETS präsentiert neue, einzigartige und zutiefst persönliche Teppiche aus dem Iran, die zusammen mit den Geschichten ihrer Schöpfer:innen in einer poetischen, filmischen und sensorischen Weise erfahrbar werden.
Dabei erzeugt die Ausstellung eine Irritation zwischen dem bloßen Teppich und dem Teppich: Was wäre, wenn Weber:innen statt Auftragsarbeiten und vom Markt vorgegebene Motive ihre eigene Geschichte weben würden? Ihre eigenen Namen, Geschichten, Farben, Muster und Ästhetik mit den Teppichen verknüpfen?
In den Teppichen erzählen Kunstweber*innen aus der Region Nord-Khorasan im Iran ihre Geschichten und verleihen ihrem Handwerk nicht nur als Kunst, sondern auch als Medium des Geschichtenerzählens eine neue Gestalt. Die Ausstellung bricht so mit einer Ordnung, einem System der Teppichproduktion und des Teppichhandels, das die Weber:innen zu bloßen Maschinen macht. Die präsentierten Teppiche mit ihren Geschichten regen zum Nachdenken über die verborgenen Geschichten und kulturellen Zusammenhänge ihrer Entstehung und Bedeutung an und laden zur Auseinandersetzung mit der Jahrhunderte andauernden Marginalisierung und Ausbeutung von Weber:innen ein.
Die ausgestellten Teppiche sind das Ergebnis des gemeinsamen Forschungsprojekts „Weaving Memories“ von Tahereh Aboofazeli (Universität zu Köln) und Arjang Omrani (Ghent Universität), das Kunstweber*innen aus der Region Nord-Khorasan im Iran eine Plattform bietet, ihre Geschichten zu erzählen. Nord-Khorasan hat eine lange Tradition der Teppich- und Kelimweberei. Zehn Kunstweber*innen, sogenannte Artist Weavers, aus dieser Region haben am Projekt „Weaving Memories“ teilgenommen. Davon sind vier Artist Weavers mit eigenen Teppichen an der Ausstellung in Siegen beteiligt: Masoumeh Zolfaghari Asieh Davari Saheb Jamal Rahimi Taqan Beik Barzin Zohreh Parvin. Zoleikha Davari unterstützt mit zusätzlich stabilisierenden Webarbeiten.
Besucher:innen sind eingeladen, mehr über das Leben und Handwerk des Teppichwebens und seine globalen und lokalen Zusammenhänge zu erfahren.
Eröffnung
Montag, 6.10. ab 17
regulär geöffnet
Mittwoch bis Freitag 15-19 Uhr
Samstag & Sonntag 13-18 Uhr
Jedes Wochenende: Teppich-Café mit kostenlosem Gebäck, Kaffee & Tee.
Ort
POOOL
Kunstraum der Gruppe 3/55 e.V.
Löhrstr. 3, Siegen
Die Ausstellung wird kuratiert von Tahereh Aboofazeli (Universität zu Köln) und Arjang Omrani in Kooperation mit dem DFG-geförderten Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ an der Universität Siegen.
Research on AI, Big Data Processing & Synthetic Media
The CRC “Media of Cooperation” launches its Critical Data School initiative at the University of Siegen with the international Autumn School “Synthetic Imaginaries: The Cultural Politics of Generative AI”.
The rise of artificial intelligence (AI), big data processing, and synthetic media has profoundly reshaped how culture is produced, made sense of, and experienced today. To ‘synthesize’ is to assemble, collate, and compile, blending heterogeneous components into something new. Where there is synthesis, there is power at play. Synthetic media—as exemplified by the oddly prophetic early speech synthesizer demos—carry the logic of analog automation into digital cultures where human and algorithmic interventions converge. Much of the research in this area—spanning subjects as diverse as augmented reality, avatars, and deepfakes—has revolved around ideas of simulation, focusing on the manipulation of data and content people produce and consume. Meanwhile, generative AI and deep learning models, while central to debates on artificiality, raise political questions as part of a wider social ecosystem where technology is perpetually reimagined, negotiated, and contested: What images and stories feed the datasets that contemporary AI models are trained on? Which imaginaries are reproduced through AI-driven media technologies and which remain latent? How do synthetic media transform relations of power and visibility, and what methods—perhaps equally synthetic—can we develop to analyze these transformations?
About the Autumn School
The five-day event at the University of Siegen explores the relationship between synthetic media and today’s imaginaries of culture and technology, which incorporate AI as an active participant. By “synthetic,” we refer not simply to the artificial but to how specific practices and ways of knowing take shape through human-machine co-creation. Imaginaries, in turn, reflect shared visions, values, and expectations—shaping not only what technologies do but how they are perceived and made actionable in everyday life.
Event Highlights
The five-day event features three keynotes and opens with a conference that brings together a total of six panels with contributions by scholars from Hong Kong, Norway, Australia, Germany, Austria, Romania, Slovenia, Spain, Taiwan, and the UK.
Our keynotes
- “Synthetic Narration: Do AI-generated stories flatten cultural diversity?” by Jill Walker Rettberg (Center for Digital Narrative, University of Bergen)
- “Synthetic situations: Ethnographic strategies for post-artificial worlds” by Gabriele de Seta (Center for Digital Narrative, University of Bergen)
- “Design Research with visual generative AI: failures, challenges, and research pathways” by Ángeles Briones (DensityDesign Lab, Politecnico di Milano)
From the second day onwards, the Autumn School moves into hands-on workshops and project work facilitated by a team of interdisciplinary scholars and data designers.
Mix questions! Monday, 8 September
Day one opens space for emerging questions—think of it as an idea hub. The panels explore diverse topics, from identities and digital narratives to platforms, infrastructures, and the politics of AI. The discussion-focused format invites participants to pose questions, share concepts, and highlight methodological challenges in an open exchange, rather than focusing on individual presentations.
Mix methods! Tuesday, 9 September-Thursday, 11 September
The next three days are about exploring new methods—hands-on! Each of our project teams will present a research question alongside a specific method to be collaboratively explored. Participants will not only learn how to design prompts and work with AI-generated text and images, but also how to critically account for genAI models as platform models. All projects draw on intersectional approaches, combining qualitative and quantitative data to explore the synthetic dimensions of AI agency—with contributions by Gabriele De Seta (University of Bergen), Marcus Burkhardt (University of Paderborn), Hendrik Bender (University of Siegen), Marloes Geboers (University of Amsterdam), Elena Pilipets (University of Siegen), Riccardo Ventura (Politecnico di Milano), Andrea Benedetti (Politecnico di Milano), Ángeles Briones (Politecnico di Milano), Carolin Gerlitz (University of Siegen), Sara Messelaar Hammerschmidt (University of Siegen), Jill Walker Rettberg (University of Bergen).
Synthesize! Friday, 12 September
The final day is dedicated to sharing, reflecting, and synthesizing the questions, methods, and insights developed throughout the week. Project teams will present their collaborative processes, highlight key takeaways, and discuss how their ideas and approaches shifted through hands-on experimentation with methods.
The Autumn School is organized by the DFG-funded Collaborative Research Centers Media of Cooperation (SFB 1187) and Transformations of the Popular (SFB 1472) together with the Center of Digital Narrative in Bergen, the Digital Culture and Communication Section of ECREA and the German National Research Data Infrastructure Consortium NFDI4Culture.
„The datafied Web“ und die Anfänge des Webtrackings
Erinnern Sie sich…
… an die Anfänge des Internets in den 90er Jahren?
… die Einführung von Webanalysen?
… an die digitalen Pioniere, die begannen unsere Online-Aktivitäten zu tracken?
… die Neuheit, Webseitenbesuche in Echtzeit zu messen?
… an die auffälligen Grafiken, die zur neuen ‚Währung‘ im Netz wurden?
… die Anfänge von Unternehmen wie Webtrends, Urchin und DoubleClick?
Mit über 40 Vorträge widmet sich die kommende RESAW Tagung 2025 dem Thema „The datafied Web“. Im Fokus stehen die frühen Webentwicklung und die Wurzeln des datengetriebenen Webtrackings. Mehr als 70 Forschende aus 11 Ländern kommen am 5. & 6. Juni am Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ der Universität Siegen zusammen und gestalten ein vielfältiges Tagungsprogramm.
Über die RESAW Tagung und Fachcommunity
RESAW ist das Acronym für A Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials. Die RESAW-Community widmet sich der Arbeit mit dem digitalen Kulturerbe und trifft sich alle zwei Jahre auf der gleichnamigen RESAW-Konferenz. RESAW wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, eine kollaborative europäische Forschungsinfrastruktur für die Erforschung von und mit Web-Materialien aufzubauen und den europäischen Wissensaustausch zu fördern.
Webinhalte sind ephemere Objekte: Sie sind kurzlebig, kontextgebunden oder anlassspezifisch. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Webseite beträgt gerade einmal zwei Monate. Dies stellen Forschung und Archivierung von webbasierten Informationen und Objekten vor immense Herausforderungen.
RESAW 2025 – The Datafied Web an der Siegen Universität
Die sechste RESAW-Konferenz widmet sich der Suche nach den historischen Wurzeln des datengetriebenen Paradigmas in der Web-Entwicklung. Dabei werden Trends, Entwicklungslinien und Genealogien eines datafizierten und metrisierten Webs sowie des Aufkommens plattformgetriebener Ökosysteme näher analysiert. Eine Untersuchung des historischen Kontexts, der Ästhetik und der Rolle von Webzählern, Analysetools, mobiler Sensorik und anderer Metriken kann dazu beitragen, ein tieferes Verständnis von Online-Interaktionen, vergangenen Öffentlichkeiten und Zielgruppen sowie deren (mitunter problematischen) Entwicklungen zu gewinnen.
Das Thema „Das datafizierte Web“ wirft auch Fragen zu Methoden und (Web-)Archiven auf, die es ermöglichen, diese Entwicklung zu erforschen: Welche Herausforderungen und Methodologien gibt es beispielsweise bei der Archivierung des metrisierten und zunehmend mobilen Webs, einschließlich der Back-End-Infrastruktur? Darüber hinaus lädt das Thema dazu ein, die historische Entwicklung der Datenerfassung und die Evolution von Praktiken der Datenüberwachung im Web nachzuzeichnen. Ergänzend dazu sind Fragen zur historischen Entwicklung von Tracking-Mechanismen, Cookies und der Entstehung digitaler Fußabdrücke relevant, ebenso wie die Evolution von Unternehmen, die auf Metriken angewiesen sind, sowie die Entwicklung finanzialisierter Webräume und deren Auswirkungen.
Die Konferenz blickt dabei aus der historischen Webanalyse heraus auf medialisierte Umwelten und stellt die Frage: Wie hat das datafizierte Web die sensorischen Medienumgebungen geschaffen, in denen wir heute leben?
Highlights der RESAW 2025
Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der RESAW-Konferenz findet ein von Niels Brügger organisierte Podiumsdiskussion statt. Vorzumerken ist der Freitagnachmittag am 6. Juni.
Besondere Highlights der diesjährigen Jahrestagung sind die Keynotes am Donnerstagabend und Freitagmorgen von Nanna Bonde Thylstrup, Associate Professor in Modern and Digital Culture an der University of Copenhagen und Jonathan Gray, Reader in Critical Infrastructure Studies, Department of Digital Humanities am King’s College in London. Nanna Bode Thystrup wird über „Vanishing points: technographies of data loss“ sprechen und sich kritisch mit Datenverlust und technographischen Zugängen zum Verschwindens auseinandersetzen. Jonathan Gray wird in seiner Keynote „Public data cultures“ die rechtlichen und technischen Konventionen offener Daten historisieren.
Gemeinsam verfolgen die Keynote-Vortragenden das Ziel, den Begriff und die Praktiken von Daten neu zu betrachten: Webdaten sind kulturelles Material, Medium der Partizipation und Ort transnationaler Koordination.
Insgesamt 22 Panels bieten bei der RESAW25 Raum für über 70 Vorträge von Siegener und internationalen Wissenschaftler*innen – unter anderem aus der Partneruniversität in Luxembourg sowie aus den Niederlanden, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Dänemark, Belgien, den USA, Portugal und Israel.
Am ersten Tag beleuchten Panels u.a. die Themenfelder rund um Plattformen und Social Media, Monetarisierungs- und Archivpraktiken im Web sowie den Umgang mit Dataverlust. Am zweiten Tag stehen u.a. das Skybox Forschungsprogramm, die Geschichte von Plattformen und Forschungsmethoden im Fokus.
Die Tagung verspricht spannende Einblicke in aktuelle Forschungsfragen rum um Trends, Entwicklungslinien und Genealogien eines datafizierten und metrisierten Webs sowie einen kritischen Dialog über die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Aufkommen palttformgetriebener Ökosysteme einhergehen.
The 2025 RESAW Konferenz wird organisiert vom Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ der Universität Siegen in Kooperation mit dem Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) an der Universität Luxembourg. Die Konferenz wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Luxembourg National Research Fund (FNR).
Knowledge, transfer and partners in research and public engagement
What is the role of Researchers in local, regional and national innovation ecosystems? Our training series discusses new ways and methods to engage with stakeholder and reflect on the impact our research might have. All parts will be lead by city2science.
About the workshop series
Openness, transparency and the ability to communicate with diverse audiences inside and outside academia are key competences in 21st century research and innovation. Transferrable skills in the areas of science communication and public engagement are increasingly relevant for academic and non-academic career paths, as well as for the acquisition of national and international funding. The interdisciplinary and interactive training series invites researchers to gain practical skills in science communication and public engagement. The course will empower researchers via a mix of input, reflections and practical sessions. A major goal of the training will be to enable participants to develop a communication plan related to (their individual) research topics and to communicate their key messages to diverse audiences in a clear and effective way.
Part #1: Start the Dialogue, Open Up Science! – Introduction to Science Communication and Public Engagement
-
Current developments in science communication and public engagement
-
Key concepts in science communication
-
Identification of potential target groups and stakeholder
-
Reflecting roles and responsibilities of researchers in science communication
-
Clarification of individual needs in science communication
Part #2: Open Science and Open Innovation in Science Communication
-
Open Science and Open Innovation as a collaborative approach to research and development
-
Development of external collaborations and broader networks of stakeholders, including other researchers, industry experts, customers, and multiple publics outside academia
-
Integration of open innovation practices into own research processes
-
How to approach new and relevant stakeholders and how to engage in open innovation processes
-
Discussing benefits and challenges associated with Open Science and Open Innovation
-
Discovering the innovation potential of your own research
Part #3: Communication Strategies and Pathways to Impact
-
How to plan strategic communication and engagement activities related to (individual) research topics
-
Develop skills and get to know concrete tools for clearly communicating research to target audiences and potential stakeholders
-
Introduction to “Challenge- and Impact-Driven” research and communication
-
Measures to maximize impact: Communication, dissemination and exploitation strategies
-
Using different communication tools with a focus on Social Media, e.g. how to create a research(er’s) profile on Social Media
Part #4: Stakeholder Engagement and Engagement Formats
-
Basic understandings of research with and for society
-
From information to collaboration: Ways to engage multiple publics with research
-
Develop concepts and initial strategies for research projects
-
Learn how to plan strategic communication and engagement activities related to research
-
Concrete tools to clearly communicate research results to the respective target groups and potential stakeholders
-
Innovative approaches and formats for science communication including ideas for creative event formats
About city2science
city2science supports strategic alliances between city and campus and develops innovative formats of science communication.
city2science offers individual consulting services for universities and research institutions as well as cities, municipalities and regions, including consulting and application development, especially in European funding programs
city2science has internationally recognized expertise in the theory and practice of science communication and public engagement. Based on many years of experience in theoretical reflection as well as in the practical implementation of innovative strategies and formats of science communication, city2science offers a comprehensive range of services in this permanently evolving future field.
Wie gestalten wir den digitalen Euro als neues Medium der Kooperation?
Mit Sebastian Gießmann (Universität Siegen. SFB 1187) und Petra Gehring (TU Darmstadt)
Sebastian Gießmann und Petra Gehring diskutieren am 26. Mai auf der diesjährigen re:publica über den digitalen Euro, seine Zukunft und Kontroversen. Das re:publica Festival widmet sich Themen der digitalen Gesellschaft.
Über den Beitrag
2025 wird ein entscheidendes Jahr für den digitalen Euro. Die Europäische Zentralbank steckt mitten in der Vorbereitungsphase für diese neue Form des Bargelds. Währenddessen stockt der nötige politische Prozess in Brüssel. Dabei ist das Projekt immer noch vielen Bürger:innen unbekannt: Im Juni 2024 wussten 59 Prozent der Deutschen nichts über die digitale Zentralbankwährung. Und wer schon davon gehört hat, vermutet vieles – angefangen bei der (keinesfalls geplanten) Abschaffung von Schein und Münze, befürchteter finanzieller Überwachung bis zur Einführung einer europäischen Kryptowährung.
Wenn wir ein neues Geld der europäischen Öffentlichkeit bis 2028 realisieren wollen, braucht es deshalb vor allem: mehr zivilgesellschaftliche Aufmerksamkeit für die digitale Zentralbankwährung, mehr und genaueres Wissen, mehr Deliberation und zivilisierten Streit, mehr Kooperation, kollektives Vorstellungsvermögen und politischen Willen. Die Philosophin Petra Gehring und der Medientheoretiker Sebastian Gießmann debattieren mit Euch, wie wir den digitalen Euro unter den aktuellen Bedingungen für alle Generationen gestalten können, und müssen.
Sebastian Gießmann und Petra Gehring diskutieren über den digitalen Euro, seine Zukunft, seine Kontroversen, seine politische Philosophie, Medientheorie und Ökonomie. Alle Generationen brauchen digital cash. Aber wie gestalten wir als europäische Zivilgesellschaft ein neues Medium der Kooperation?
Die Session „Das neue Geld der europäischen Öffentlichkeit: Wie gestalten wir den digitalen Euro?“ findet am 26. Mai von 13.45-14.15 Uhr statt. Weitere Details hier →
Über die re:publica
Die re:publica ist ein Festival für die digitale Gesellschaft und die größte Konferenz ihrer Art in Europa. Die Teilnehmer*innen der re:publica bilden einen Querschnitt der (digitalen) Gesellschaft. Zu ihnen gehören Vertreter*innen aus Wissenschaft, Politik, Unternehmen, Hackerkulturen, NGOs, Medien und Marketing sowie Blogger*innen, Aktivist*innen, Künstler*innen und Social Media-Expert*innen. Die re:publica 25 fand vom 26.-28. Mai 2025 in Berlin statt. Sie steht unter dem Motto „Generation XYZ „.
Die aktive Beteiligung der Community – initiiert durch den dem Festival vorausgehenden „Call for Participation“ – macht die re:publica zu diesem einzigartigen Event. Jede*r Interessierte reicht spannende Themen, Ideen oder Projekte ein, die damit selbst Teil des Programms werden können. Unter anderem dadurch erreicht die re:publica eine hohe Themendiversität und außergewöhnliche Vernetzungsmöglichkeiten. Über 50 Prozent der re:publica-Sprecher*innen sind weiblich. Damit ist die re:publica seit langem Vorreiter und wegweisend in der Debatte rund um die Themen “Gender Balance” und “Diversity” im Allgemeinen.
Im Jahr 2007 von Tanja Haeusler, Andreas Gebhard, Markus Beckedahl und Johnny Haeusler gegründet, engagieren sich die Gesellschafter*innen der republica GmbH seit über einem Jahrzehnt in den Bereichen Netzpolitik, Digitalkultur und digitale Gesellschaft.
Über die Forschenden
Sebastian Gießmann ist Akademischer Oberrat am Seminar für Medienwissenschaften an der Universität Siegen. Er ist Teilprojektleiter des Teilprojekts „A01 – Digitale Netzwerktechnologien zwischen Spezialisierung und Generalisierung“ im DFG-geförderten Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“.
Petra Gehring ist Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt. Sie arbeitet zu einem breiten Spektrum von Themen, von der Geschichte der Metaphysik bis hin zur Technikforschung und zu den Methoden der Digital Humanities. Sie war u. a. Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin und ist derzeit Vorsitzende des Rats für Informationsstrukturen der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern sowie Direktorin des Zentrums verantwortungsbewusste Digitalisierung.
[/one_half]
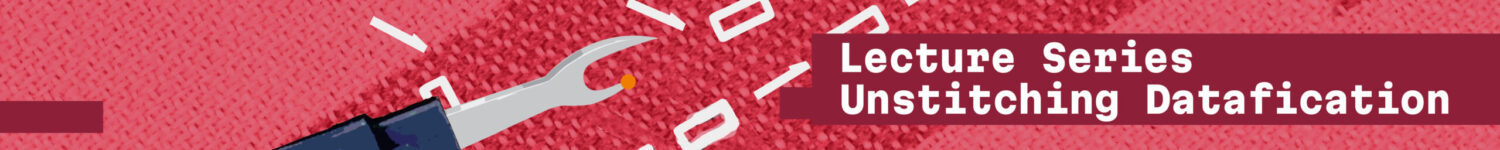
How to deconstruct and transform digital infrastructures through practices of hacking, queering, countering, and resisting
We are excited to invite you to this summer’s Lecture Series on “Unstitching Datafication”. Inspired by the seam ripper figure and historical forms of technological resistance, we invited eight guest speakers from the arts, activism and academia to explore how digital technologies can be un- and re-stitched by working on their seams.
→ Website of the Lecture Series
About the lecture series
“Unstitching Datafication” means deconstructing and transforming digital technologies by working on their ‘seams’. This means examining the social and economic relations and how they have been and can be reconfigured by technology. We invited eight speakers from arts, activism, and academia to explore the limits of digital technology and discuss what it means to intentionally create seams, ruptures, and breakdowns within digital technologies and infrastructures. Even partial unstitching generates holes in the digital fabric that expose the inner workings of opaque digital systems. These holes create openings and opportunities to intervene in structures and algorithmic logic, allowing us to envision utopian futures and alternative digitalities.
The lecture series uses the figure of the seam ripper, or unstitcher, as a textile metaphor to permeate the digital realm, drawing inspiration from previous research: Mark Weiser’s notion of ubiquitous computing famously rests on the ideal of seamless data transfer, devices inform net-work connections, and the World Wide Web remains the most expansive digital fabric. The connection between weaving and computing runs deep. Ellen Harlizius-Klück called automatic weaving a “binary art”, which paved the way for one of the first machines to be operated by punched cards: the Jacquard loom in the early 19th century.
Using the figure of the unstitcher, we understand glitches and noise, the unintended yet often revealing features of digital systems, as options for productive resistance, disconnection, and subversion. Media theory, human geography, gender studies, and critical theory understand these moments as “glitch epistemologies” (Leszczynski & Elwood), “glitch politics” (Alvarez Léon), “queer counter conduct” (Lingel) or even “anti-fascist approach to artificial intelligence” (McQuillan). The often unassuming actions of resistance or obfuscation that lead to the unstitching and, ultimately, to the unravelling of digital processes expose the inherent fragility of digital systems and create spaces for creative interventions and counteraction.
Yet, instead of emphasizing the ‘textility’ of our digital world, the eight lectures focus on how to disrupt the digital world and the seams and frictions of datafication, where knowledge emerges, and resistance takes shape. Building on ‘unstitching datafication’, the series examines the flaws and breakdowns in the supposedly seamless connectivity of today’s technologies.
Lectures & Speakers
We invited eight guest speakers from the arts, activism and academia. They come from the Netherlands, Sweden, Switzerland, USA, Germany and Great Britain. In their lectures, they will focus on practices that can challenge, disrupt, and reconfigure existing norms and structures within digital environments where the sensing and sense-making of people, media, and sensors become intertwined. Thus, our speakers will move beyond the destructive aspect inherent to unstitching seams and networks and instead ask how digital technologies can be unstitched through hacking, queering, countering, and resisting datafication and ‘data colonialism’ – be it through technical manipulations, artistic interventions, or activist action.
#1 Luddite Futures
Wed, 16.04.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid
Gavin Mueller (University of Amsterdam) ➞
#2 Queer Tactics of Opacity: Resisting Public Visibility and Identification on Sexual Social Media Platforms
Wed, 07.05.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid
Jenny Sundén (Södertörn University Stockholm) ➞
#3 De/Tangling Resolution
Wed, 14.05.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid
Rosa Menkman (HEAD Genève) ➞
#4 Against ‘Method’ or How to Assume a ‘Differend’
Wed, 21.05.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid
David Gauthier (Utrecht University) ➞
#5 Data Grab: The New Colonialism of Big Tech and How to Fight Back
Wed, 28.05.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid
Ulises A. Mejias (SUNY Oswego) ➞
#6 Glitchy Vignettes From Agricultural Repair Shops
Wed, 18.06.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid
Alina Gombert (Goethe-Universität Frankfurt a. M.) ➞
#7 Affects Beyond Our Technological Desires
Wed, 02.07.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid
Sara Morais dos Santos Bruss (HKW Berlin) ➞
#8 Decomputing as Resistance
Wed, 16.07.25 | 2.15-3.45 PM | Hybrid
Dan McQuillan (Goldsmiths, University of London) ➞
Event Details
- Dates: April 16 – July 16, 2025
- Location: University of Siegen, Herrengarten 3, Room: AH-A 217/18
- Streaming: via Webex
- Time: Wednesdays, 2:15 AM – 3:45 PM CET
How to Register
All events take place in hybrid form (on-site and via Webex). No registration is required if you would like to attend on-site. To attend the lecture online via Webex, please register here →
For more information about the program and detailed schedule, visit the lecture series’ website.
Contact
Follow us
Follow us on social media for more updates →
#CRC2025 #Unstitching #glitch #DataColonialism #luddism
Thank you, and we hope to see you there!
Literature
Alvarez Léon, L. F. (2022). “From glitch epistemologies to glitch politics.” Dialogues in Human Geography 12(3), 384-388, DOI: 10.1177/20438206221102951.
Harlizius-Klück, E. (2017). “Weaving as Binary Art and the Algebra of Patterns.” TEXTILE 15(2), 176–197, DOI: 10.1080/14759756.2017.1298239.
Leszczynski, A., & Elwood, S. (2022). “Glitch epistemologies for computational cities.” Dialogues in Human Geography 12(3), 361-378, DOI: 10.1177/20438206221075714.
Lingel, J. (2020). “Dazzle camouflage as queer counter conduct.” European Journal of Cultural Studies 24(5), 1107-1124, DOI: 10.1177/1367549420902805.
McQuillan, D. (2022). Resisting AI: An Anti- Fascist Approach to Artificial Intelligence. Bristol: Bristol University Press.
The datafied Web – 6th RESAW 2025 conference
June 4 – 6, 2025, at the University of Siegen
Registration for the 6th RESAW conference (June 4-6) is now open. You can register on our conference website until May 15th.
About the registration
Registration for the pre-conference is not mandatory but highly appreciated. Spontaneous participation is also welcome. During registration, please indicate whether you will be joining us for dinner. Vegetarian and vegan options will be available. If you have specific dietary requirements, don’t hesitate to get in touch with the organizers. We aim to include precarious scholars—please contact the organizers if you need support or would like to discuss possible options. Email: RESAW25-datafiedweb[æt]uni-siegen.de
About the conference
We look forward to more than 40 presentations by over 70 researchers from 11 countries who shape the amazing program of the 6th RESAW 2025 conference. The conference will take place on June 4-6 at the University of Siegen.
The conference promises insightful discussions on current research questions related to the trends, trajectories, and genealogies of a datafied and metric-driven web. It will also foster critical dialogue on the challenges and opportunities posed by the rise of platform-driven ecosystems.
For more information about the program and detailed schedule, visit the conference website datafiedweb.net.
Follow us on social media for more updates ➞
#CRC2025 #resaw25 #webhistory #webarchives #datafication #archives
The 2025 RESAW conference is organized by the Collaborative Research Centre 1187 “Media of Cooperation” at the University of Siegen in cooperation with the Centre for for Contemporary and Digital History (C²DH) at the University of Lux-embourg. The conference is funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) and the Luxembourg National Research Fund (FNR).

Location
University of Siegen
Campus US-C and US-S
Obergraben 25
57072 Siegen
Conference Program
See the conference programme on our website www.datafiedweb.net/program.
Das neue Sommerprogramm
Wir begrüßen unsere Mitglieder wieder zum neuen Semester- und Sommerprogramm.
Wir freuen uns, unser kommendes Sommerprogramm ankündigen zu können, das Folgendes umfasst
- mehrere Workshops und Konferenzen, darunter die RESAW 2025-Konferenz „The Datafied Web“, die gleichzeitig die SFB Jahrestagung ist,
- die Ringvorlesung „Unstitching Datafication“, und
- drei MGK Masterclasses (Workshop [Medien] Praxistheorie),
- das MGK Writing Retreat und Forschungskolloquium,
- und eine Summer School.
Die aktuelle Ausgabe des Forschungsforums widmet sich der Wissenschaftskommunikation und öffentlichem Engagement mit Workshops zu Open Science, Kommunikationsstrategien und Stakeholder Engagement.
Es erwarten uns anregende Vorträge und spannende Diskussionen. Wir sehen uns in Siegen oder online!

Talkrunde “TikTok hacken? Protest und Bildung auf Videoplattformen”
moderiert von Julia Bee (Ruhr-Universität Bochum) und Jasmin Degeling (Bauhaus-Universität Weimar)
Wie kann TikTok als Plattform für politische Bildung und queerfeministischen Aktivismus genutzt werden? In der Talkrunde „TikTok hacken? Protest und Bildung auf Videoplattformen“ werfen Medienwissenschaftler*innen sowie Content-Creator*innen einen kritischen Blick auf die Möglichkeiten von TikTok als Raum für demokratische Diskussionen.
Veranstaltungsinfos
21. Februar 2025, 19 Uhr
Quartiershalle in der KoFrabrik
Stühmeyerstraße 33
44787 Bochum
Über die Talkrunde
In dieser Talkrunde mit Ole Liebl, Caspar Weimann, Judith Ackermann, Jennifer Eickelmann und Philipp Hohmann diskutieren die Hosts Julia Bee und Jasmin Degeling über Protest und Bildung auf TikTok.
Vor dem Hintergrund, dass digitale Plattformen zur gesellschaftlichen Faschisierung beitragen und insbesondere rechte politische Strategien von digitalen Medien profitieren, diskutieren die Teilnehmenden, welche Formate und künstlerischen Praktiken auf TikTok und Co. im Sinne der politischen Bildung und des queerfeministischen Aktivismus demokratiefördernd wirken.
TikToker*innen thematisieren auf ihren Kanälen kritisch antifeministische und rechte (Online-)Radikalisierung, Männlichkeitskritik, Queer Joy, Sexualität und Gender. Sie positionieren sich queerfeministisch und antifaschistisch und setzen sich für die queere Community ein.
In der Talkrunde diskutieren Content-Creator*innen mit Medienwissenschaftler*innen die Möglichkeiten der politischen Bildung und einer demokratischen Medienkultur auf TikTok. Seid dabei und diskutiert mit uns über TikTok als Möglichkeit der politischen Bildung und welche Rolle wir dabei spielen können.
Über die Teilnehmenden Diskutierende: Ole Liebl (Content Creator, @oleliebl) Moderation: Julia Bee (Professorin für Gender Media Studies unter besonderer Berücksichtigung von Diversität, Ruhr-Universität Bochum; SFB 1187 „Medien der Kooperation“, Teilprojekt B09 – „Fahrradmedien: Kooperative Medien der Mobilität“)
Caspar Weimann (Honorarprofessor*in und Mentor*in für Schauspiel an der ADK Baden-Württemberg; @onlinetheater.live)
Philipp Hohmann, (KosmoPolis – eingetragener Verein für queere Nachtkultur; @ovalofficebar)
Jennifer Eickelmann (Juniorprofessorin für Digitale Transformation in Kultur und Gesellschaft, FernUniversität in Hagen)
Judith Ackermann (Forschungsprofessorin für Digitale Medien und Performance in der Sozialen Arbeit, Fachhochschule Potsdam; @dieprofessorin)
Jasmin Deneling (Juniorprofessor*in für Medienanthropologie, Bauhaus-Universität Weimar)
Die Talkrunde ist organisiert von der Professur Gender Media Studies unter besonderer Berücksichtigung von Diversität an der Ruhr-Universität Bochum, der Professur Medienanthropologie an der Bauhaus-Universität Weimar, dem DFG-Forschungsnetzwerk Gender, Medien und Affekt und KosmoPolis e.V.
RESAW 2025 – The datatfied Web
Über 40 Vorträgen von mehr als 70 Forschenden aus 11 Ländern gestalten das Tagungsprogramm der RESAW Tagung 2025, die am 5. & 6. Juni am Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ in Siegen stattfindet. Registrierungen sind ab März 2025 möglich.
Über die RESAW Conference und Community
RESAW ist das Acronym für A Research Infrastructure for the Study of Archived Web Materials. Die RESAW-Community widmet sich der Arbeit mit dem digitalen Kulturerbe und trifft sich alle zwei Jahre auf der gleichnamigen RESAW-Konferenz. RESAW wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, eine kollaborative europäische Forschungsinfrastruktur für die Erforschung von und mit Web-Materialien aufzubauen und den europäischen Wissensaustausch zu fördern.
Webinhalte sind ephemere Objekte: Sie sind kurzlebig, kontextgebunden oder anlassspezifisch. Die durchschnittliche Lebensdauer einer Webseite beträgt gerade einmal zwei Monate. Dies stellen Forschung und Archivierung von webbasierten Informationen und Objekten vor immense Herausforderungen.
RESAW 2025 – The Datafied Web an der Siegen Universität
Die sechste RESAW-Konferenz widmet sich der Suche nach den historischen Wurzeln des datengetriebenen Paradigmas in der Web-Entwicklung. Dabei werden Trends, Entwicklungslinien und Genealogien eines datafizierten und metrisierten Webs sowie des Aufkommens plattformgetriebener Ökosysteme näher analysiert. Eine Untersuchung des historischen Kontexts, der Ästhetik und der Rolle von Webzählern, Analysetools, mobiler Sensorik und anderer Metriken kann dazu beitragen, ein tieferes Verständnis von Online-Interaktionen, vergangenen Öffentlichkeiten und Zielgruppen sowie deren (mitunter problematischen) Entwicklungen zu gewinnen.
Das Thema „Das datafizierte Web“ wirft auch Fragen zu Methoden und (Web-)Archiven auf, die es ermöglichen, diese Entwicklung zu erforschen: Welche Herausforderungen und Methodologien gibt es beispielsweise bei der Archivierung des metrisierten und zunehmend mobilen Webs, einschließlich der Back-End-Infrastruktur? Darüber hinaus lädt das Thema dazu ein, die historische Entwicklung der Datenerfassung und die Evolution von Praktiken der Datenüberwachung im Web nachzuzeichnen. Ergänzend dazu sind Fragen zur historischen Entwicklung von Tracking-Mechanismen, Cookies und der Entstehung digitaler Fußabdrücke relevant, ebenso wie die Evolution von Unternehmen, die auf Metriken angewiesen sind, sowie die Entwicklung finanzialisierter Webräume und deren Auswirkungen.
Die Konferenz blickt dabei aus der historischen Webanalyse heraus auf medialisierte Umwelten und stellt die Frage: Wie hat das datafizierte Web die sensorischen Medienumgebungen geschaffen, in denen wir heute leben?
Highlights der RESAW 2025
Anlässlich des 10-jährigen Bestehens der RESAW-Konferenz findet ein von Niels Brügger organisierte Podiumsdiskussion statt. Vorzumerken ist der Freitagnachmittag am 6. Juni.
Besondere Highlights der diesjährigen Jahrestagung sind die Keynotes am Donnerstagabend und Freitagmorgen von Nanna Bonde Thylstrup, Associate Professor in Modern and Digital Culture an der University of Copenhagen und Jonathan Gray, Reader in Critical Infrastructure Studies, Department of Digital Humanities am King’s College in London. Nanna Bode Thystrup wird über „Vanishing points: technographies of data loss“ sprechen und sich durch die Entwicklung eines technographischen Zugang der kritischen Beforschung des Verschwindens annähern. Jonathan Gray wird in seiner Keynote „Public data cultures“ die rechtlichen und technischen Konventionen offener Daten historisieren. Ziel ist es anhand einer Reihe empirischer Vignetten den Begriff und die Praktiken von Daten neu zu betrachten: als kulturelles Material, als Medium der Partizipation und als Ort transnationaler Koordination.
Insgesamt 22 Panels bieten bei der RESAW25 Raum für über 70 Vorträge von Siegener und internationalen Wissenschaftler*innen – unter anderem aus der Partneruniversität in Luxembourg sowie aus den Niederlanden, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Schweden, Dänemark, Belgien, den USA, Portugal und Israel. Am Donnerstag beleuchten Panels u.a. die Themenfelder rund um Plattformen und Social Media, Monetarisierungs- und Archivpraktiken im Web sowie den Umgang mit Dataverlust. Am zweiten Tag stehen u.a. das Skybox Forschungsprogramm, die Geschichte von Plattformen und Forschungsmethoden im Fokus.
Die Tagung verspricht spannende Einblicke in aktuelle Forschungsfragen rum um Trends, Entwicklungslinien und Genealogien eines datafizierten und metrisierten Webs sowie einen kritischen Dialog über die Herausforderungen und Chancen, die mit dem Aufkommen palttformgetriebener Ökosysteme einhergehen.
The 2025 RESAW Konfernz wird organisiert vom Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Kooperation“ der Universität Siegen in Kooperation mit dem Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) an der Universität Luxembourg. Die Konferenz wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und dem Luxembourg National Research Fund (FNR).
1 / 4
