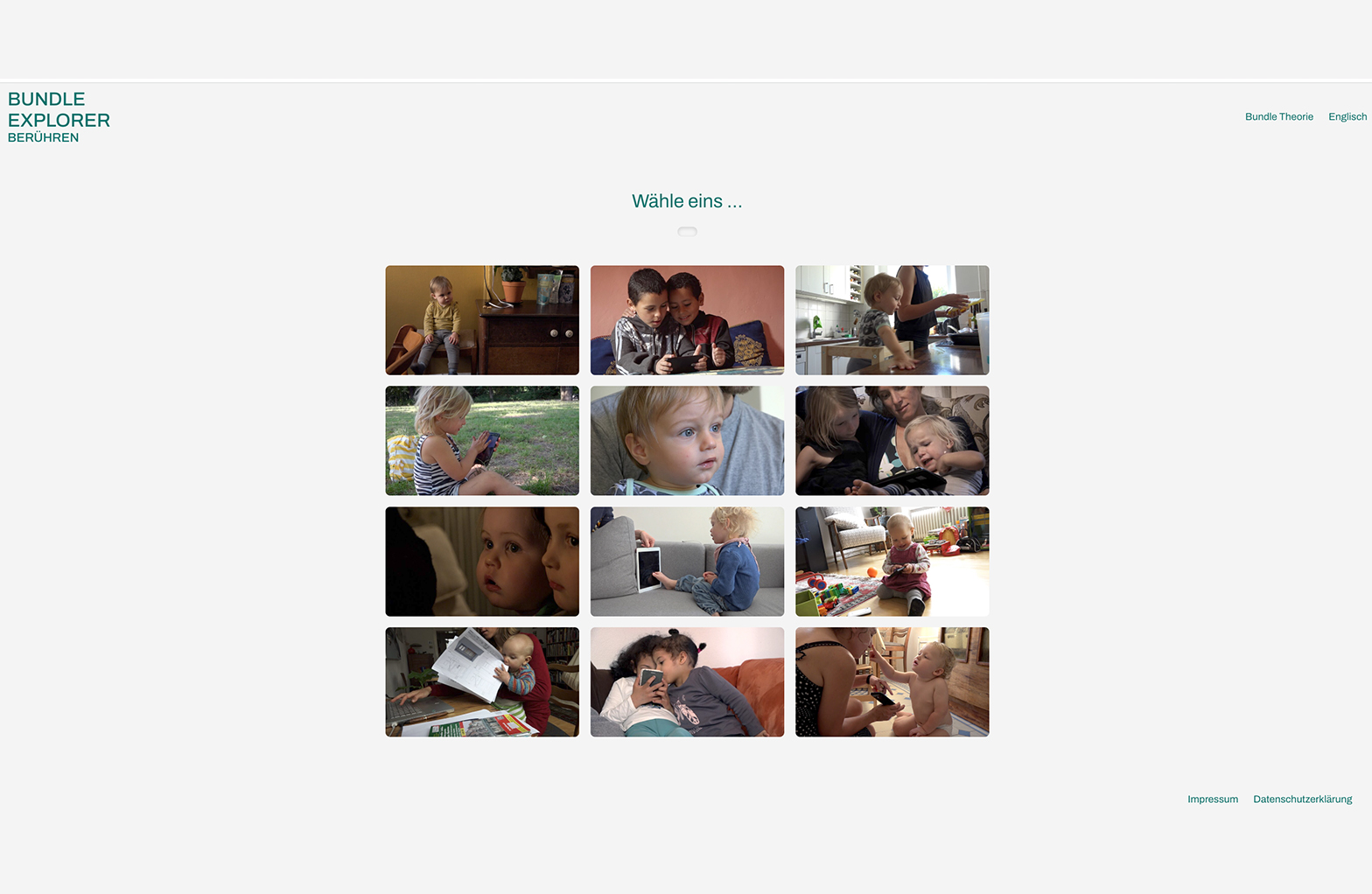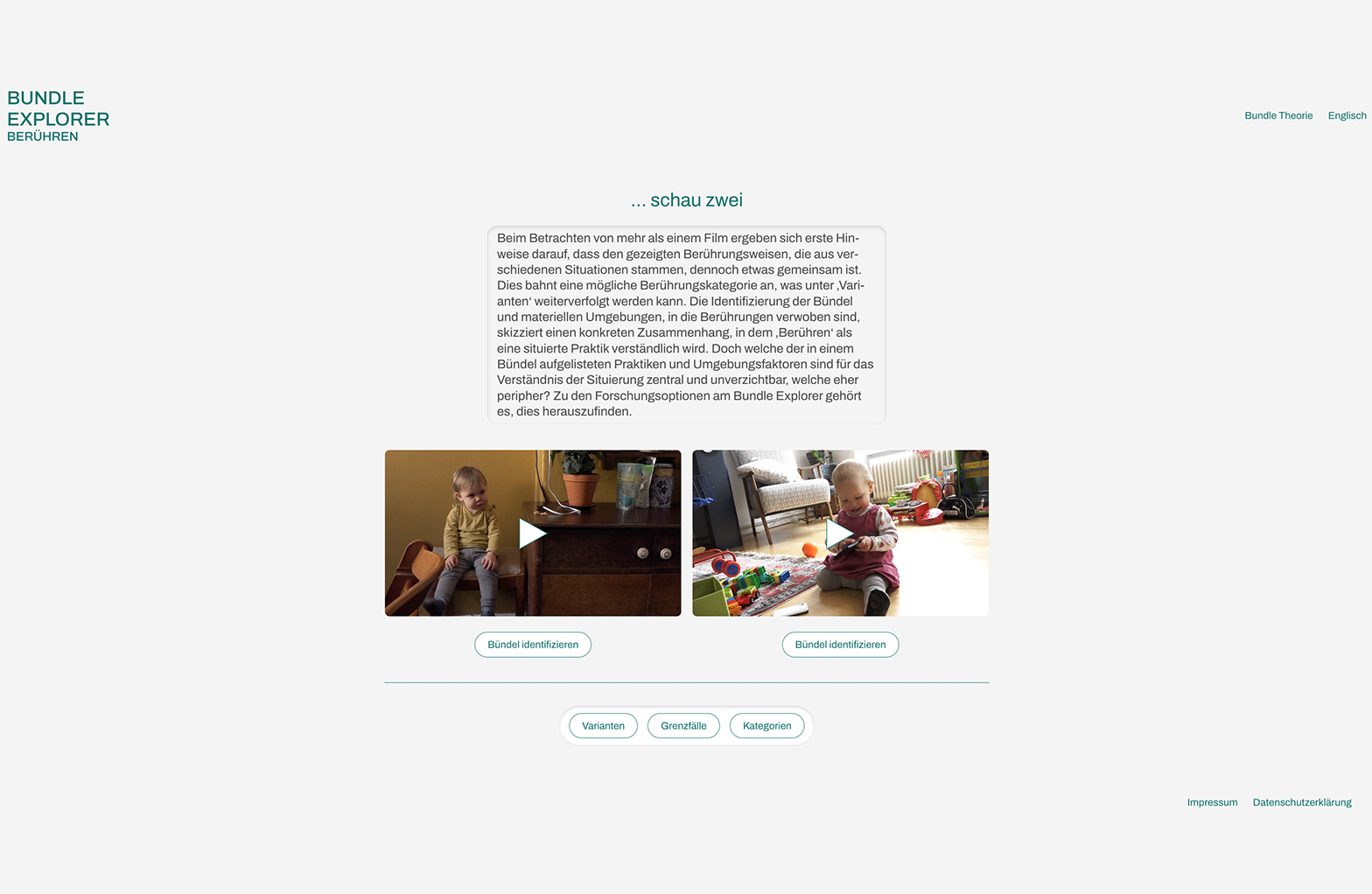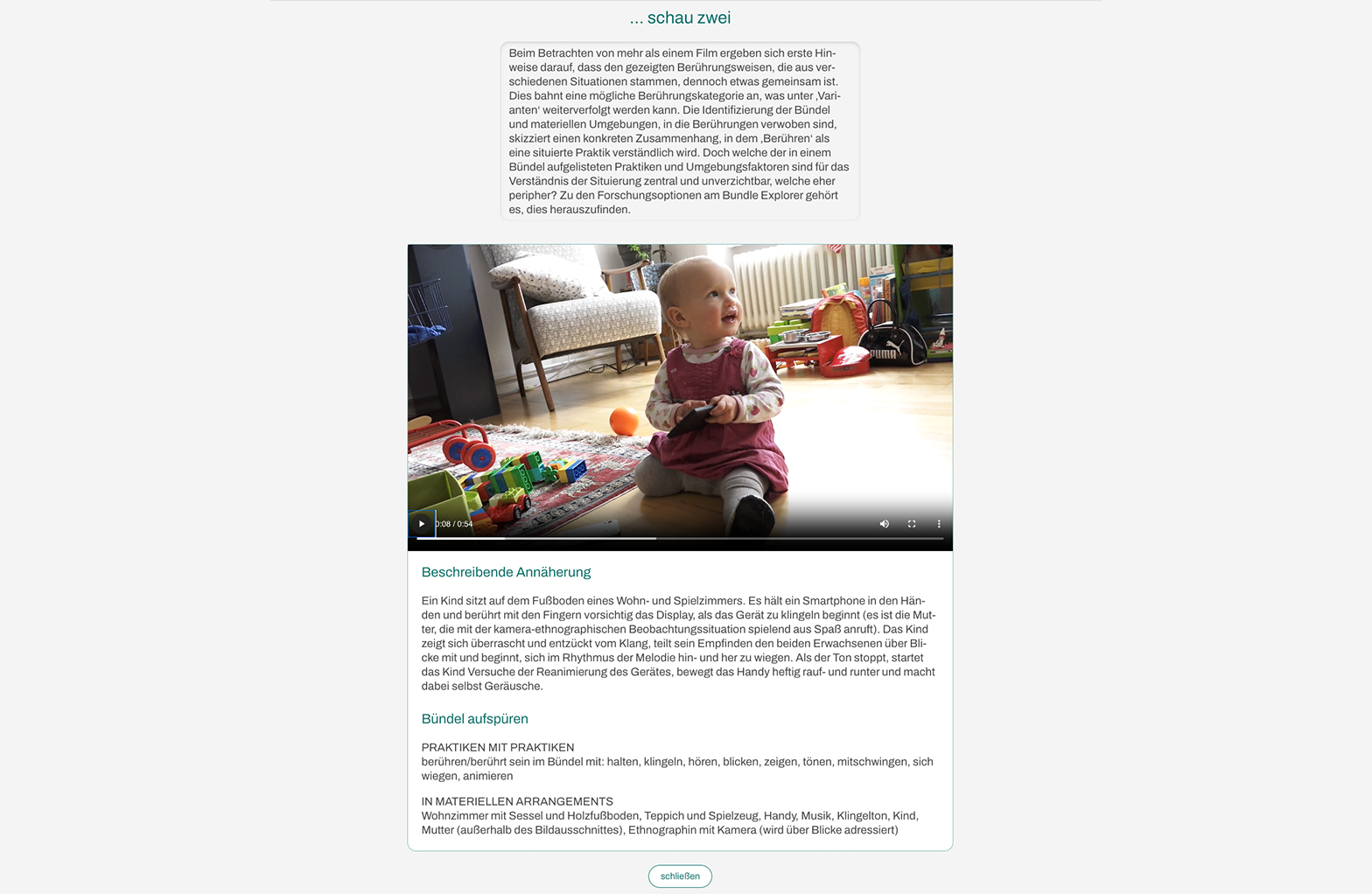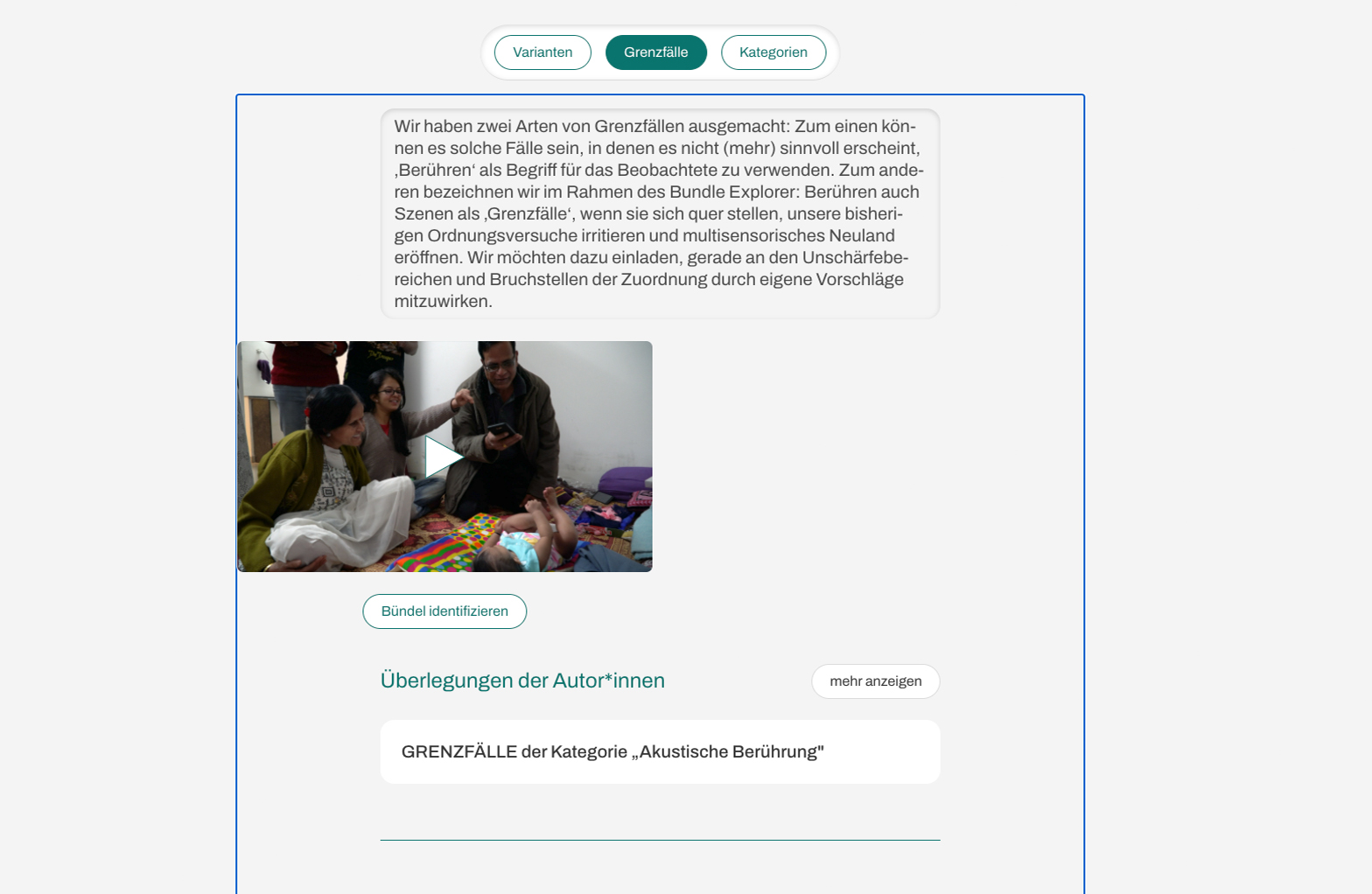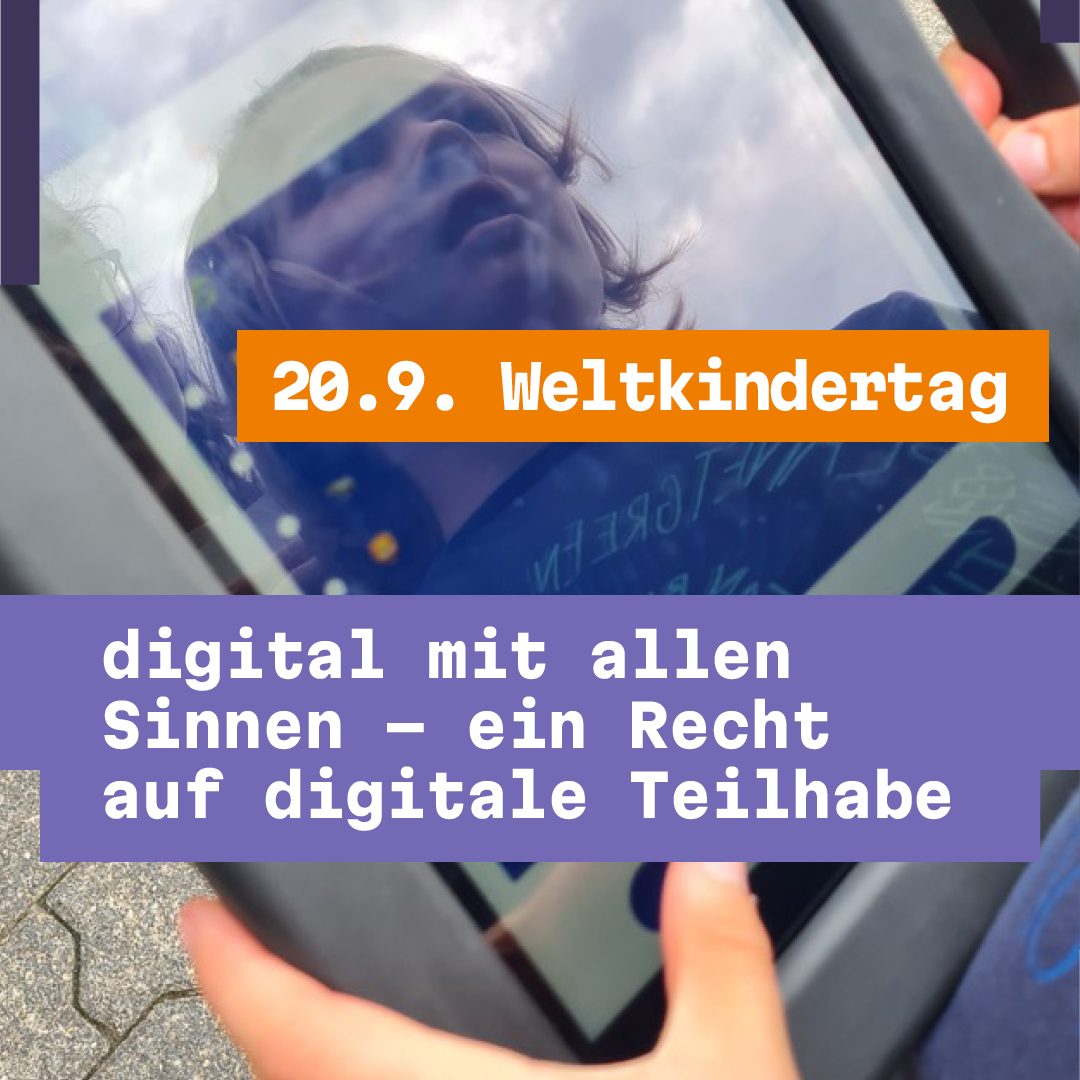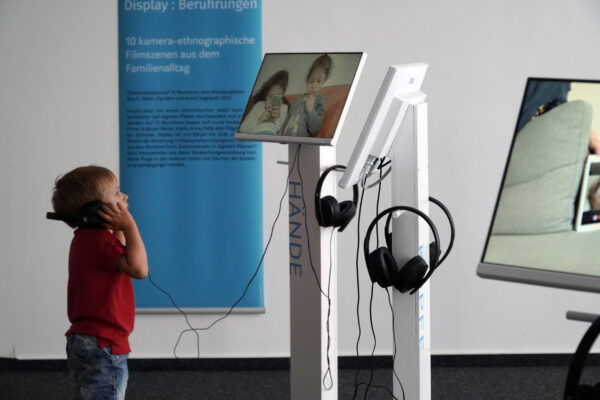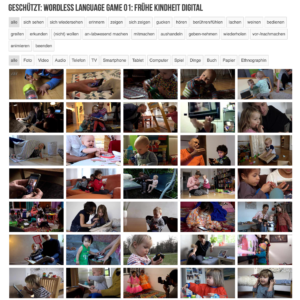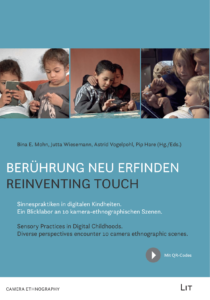Catalina Goanta, Birgit Meyer, Benjamin Peters, Jürgen Streeck und Jill Walker Rettberg sind neue Mercator Fellows am SFB 1187
Der Sonderforschungsbereich (SFB 1187) „Medien der Kooperation“ begrüßt vier neue Mercator Fellows: Catalina Goanta, Birgit Meyer, Benjamin Peters, Jürgen Streeck und Jill Walker Rettberg. Diese herausragenden Wissenschaftler*innen werden dieses Jahr ihre wissenschaftliche Expertise und innovativen Forschungsansätze in den SFB 1187 einbringen.
Über das Mercator Fellowship am SFB 1187
Um die wissenschaftliche Zusammenarbeit im Forschungsverbund zu stärken, vergibt der SFB 1187 Mercator Fellowships an herausragende Wissenschaftler*innen aus dem In- und Ausland. Mercator Fellows forschen für eine längere Zeit und enger Zusammenarbeit mit einem oder mehreren der am SFB 1187 beteiligten Teilprojekte zu Fragestellungen rund um digitaler, datenintensiver Medien. Zusammen mit den regulären Mitglieder verfolgen unsere Mercator Fellows das gemeinsame Ziel, interdisziplinäre Ansätze weiterzuentwickeln und das Forschungsprogramm des SFB mitzugestalten. Die Aufnahme dieser renommierten Forschenden stärkt nicht nur das internationale Netzwerk des SFB 1187, sondern fördert auch den Wissens- und Ideentransfer, der für die digitale Gegenwartsforschung am SFB von zentraler Bedeutung ist.
Das Mercator Fellowship ist ein Modul im Rahmen der Förderprogramme der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dient dazu, einen intensiven und langfristigen Forschungsaustausch zu ermöglichen.
Über die aktuellen Mercator Fellows
Prof. Dr. Catalina Goanta
Law, Economics and Governance
Molengraaff Institute for Private Law
University of Utrecht, the Netherlands
Über Catalina Goanta
Catalina Goantas forscht an der Schnittstelle von Recht, Technologie und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf Plattformregulierung, Content-Monetarisierung und Verbraucherrecht im digitalen Zeitalter. Als Leiterin des von der EU geförderten ERC Starting Grant-Projekts HUMANads (2022–2027) untersucht sie, wie Influencer-Marketing, algorithmische Werbesysteme und neue Formen der digitalen Arbeit rechtlich und gesellschaftlich zu bewerten sind. Neben ihrer akademischen Tätigkeit ist sie international als Expertin für Plattformregulierung gefragt.
Goanta wurde für ihre innovativen Lehr- und Forschungsansätze ausgezeichnet und hat 2017 ein Fellowship am Stanford Transatlantic Technology and Law Forum erhalten. 2018 folgte das Niels-Stensen-Stipendium. Ihre Dissertation über die Digitalisierung des Vertragsrechts an der Universität Maastricht legte den Grundstein für ihre intensiven Auseinandersetzungen mit den rechtlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen der Plattformökonomie.
Zu ihren wichtigen Publikationen zählen unter anderem der 2020 veröffentlichte Sammelband The Regulation of Social Media Influencers, in dem die Regulierung von Social-Media-Influencern aus verschiedenen Perspektiven analysiert wird und die Herausforderungen des Influencer-Marketings beleuchtet werden, sowie der 2021 veröffentlichte Artikel „A New Order: The Digital Services Act and Consumer Protection“ im European Journal of Risk Regulation, in dem der Digital Services Act (DSA) der EU aus der Perspektive des Verbraucherschutzes und der Haftung von Intermediären untersucht wird.
Prof. Dr. Birgit Meyer
Department of Philosophy and Religious Studies
Utrecht University, the Netherlands
Über Birgit Meyer
Birgit Meyer forscht als Kulturanthropologin seit über 30 Jahren zu Religion aus einer materiellen und postkolonialen Perspektive. Ihre Forschung zielt auf eine Synthese zwischen empirischer Forschung und theoretischer Reflexion in einem breiten multidisziplinären Rahmen an. Zu den Schwerpunkten ihrer Forschung gehören Religion in Afrika, der Aufstieg und die Popularität globaler Pfingstkirchen, Religion, Populärkultur und Kulturerbe, Religion in (post-)kolonialen Kontexten, Religion und Medien, Religion und Öffentlichkeit, religiöse visuelle Kultur sowie Sinne und Ästhetik.
Zu ihren wichtigen Publikationen zählen unter anderem das 2021 veröffentlichte Buch Refugees and Religion: Ethnographic Studies of Global Trajectories, das Religion aus einem materiellen und körperlichen Blickwinkel betrachtet und untersucht, wie Flüchtlinge ihre Religion ausüben und konvertieren oder neue Glaubensrichtungen entwickeln sowie der 2024 veröffentlichte Artikel „‚Idols‘ in the museum: Legacies of missionary iconoclasm“ in dem Sammelband Image Controversies: Contemporary Iconoclasm in Art, Media, and Cultural Heritage, das zeitgenössische Ikonoklasmen in Kunst, Medien und im Umgang mit dem Kulturerbe in globaler und interdisziplinärer Perspektive einer kritischen Analyse unterzieht.
Prof. Dr. Benjamin Peters
Hazel Rogers Endowed Chair in Media Studies
University of Tulsa, USA
Über Benjamin Peters
Benjamin Peters forscht in den Bereichen der Medientheorie, Geschichte neuer Medien, Technologiekritik sowie digitalen Kulturen und die Politik von Informationstechnologien, insbesondere mit Blick auf die Beziehungen zwischen neuen Technologien, Kultur und Gesellschaft und die Geschichte der sowjetischen Informatik. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde Benjamin Peters mehrfach ausgezeichnet, darunter der Computer History Museum Prize (2018) für sein Buch How Not to Network a Nation, der Wayne S. Vucinich Book Prize (2017). Für seine herausragende Lehrtätigkeit wurde er 2023 mit dem Outstanding Teaching Award der University of Tulsa ausgezeichnet.
Peters promovierte 2010 an der Columbia University im Fach Kommunikationswissenschaften. Seit 2017 ist er außerordentlicher Professor am Lehrstuhl für Medienwissenschaft an der University of Tulsa, wo er den Hazel Rogers Stiftungslehrstuhl für Media Studies inne hat. Weitere akademische Stationen führten ihn unter anderem als Fellow an die Yale Law School (2015) und an das Kate Hamburg Kolleg der RWTH Aachen (2022–2023) und an das MECS Institute of Advanced Study der Leuphana Universität (2017, 2019). Zudem war er am Berkman Klein Center for Internet & Society der Harvard University und als Gastprofessor an der Hebrew University in Jerusalem tätig.
Zu seinen wichtigen Publikationen zählt das 2016 im Open-Access veröffentlichte Buch How Not to Network a Nation: The Uneasy History of the Soviet Internet, das mehreren Auszeichnungen erhalten hat, sowie 2021 die Mitherausgeberschaft an dem Open-Access Sammelband Your Computer is on Fire, der die kritische Neubewertung der digitalen Revolution vorantreibt.
Prof. Dr. Jürgen Streeck
Department of Communication Studies, Moody College of Communication
University of Texas at Austin, USA
Über Jürgen Streeck
Jürgen Streeck forscht im Bereich multimodaler Interaktion, insbesondere zur Koordination von Sprache, Gestik und Blicken sowie der sozialen Bedeutung von Handlungen in der Kommunikation. Er hat zur Entwicklung der multimodalen Interaktionsforschung beigetragen und befasst sich mit den Verbindungen zwischen Sprache, Musik und Oralität, insbesondere im Hip-Hop. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde er mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Georg-Gottfried-Gervinus Fellowship (2013–2014). Er war Fellow am Freiburg Institute for Advanced Studies und am Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) in Bielefeld.
Streeck promovierte 1981 an der Freien Universität Berlin in Linguistik und ist seit 2013 Professor für Kommunikationswissenschaft am Department of Communication Studies der University of Texas at Austin. Zuvor war er Associate Professor am gleichen Department und hatte auch eine Professur für Sprachwissenschaften an der Freien Universität Berlin inne. Darüber hinaus nahm er Gastprofessuren und -stipendien an Universitäten wie der Universität Oldenburg, der Universität Wien und der University of Utrecht wahr.
Zu seinen wichtigen Publikationen zählt das 2009 veröffentlichte Buch Gesturecraft: The Manu-facture of Meaning, in dem Streeck untersucht, wie Handgesten in der Kommunikation die Welt darstellen und deuten, basierend auf mikroethnografischer Forschung und Theorien zu Kognition und Interaktion. In dem 2017 herausgegebenen Band Self-Making Man: A Day of Action, Life, and Language analysiert Jürgen Streeck, wie ein Automechaniker in Texas durch Gesten, Sprache und Handlungen seine soziale Welt und Identität in der Kommunikation erschafft.
Prof. Dr. Jill Walker Rettberg
Center for Digital Narrative, Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies
University of Bergen, Norway
Über Jill Walker Rettberg
Jill Walker Rettberg forscht zu den Wechselwirkungen zwischen Erzählungen und digitalen Technologien, insbesondere die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Erzählweisen und die Verbreitung von Geschichten online. Rettberg hat für ihre Arbeiten Auszeichnungen wie etwa 2017 den John Lovas Memorial Award für ihre innovative Nutzung von Social Media in der Forschung erhalten. Für ihre herausragende Forschungsarbeit wurde sie zudem mit dem Meltzer Foundation Prize for Excellence in Research Dissemination (2006) ausgezeichnet.
Jill Walker Rettberg promovierte 1998 in Informatik an der Universität Bergen. Seit 2000 teilt sie ihre Forschungsergebnisse auf ihrem Blog jill/txt und in den Sozialen Medien und war damit eine der ersten wissenschaftlichen Bloggerinnen. Seit 2014 ist sie Professorin für digitale Kultur und Co-Direktorin des Center for Digital Narrative an der Universität Bergen. Sie leitet das ERC Advanced Grant-Projekt „AI Stories: Narrative Archetypes for Artificial Intelligence“ und das ERC Consolidator Projekt „Machine Vision in Everyday Life“. Weitere akademische Stationen führten sie unter anderem als Gastprofessorin an die University of California, Berkeley (2015) und an das MIT Media Lab (2018).
Zu Jill Walker Rettbers wichtigen Publikationen zählt unter anderem das 2023 im Open-Access veröffentlichte Buch Machine Vision: How Algorithms are Changing the Way We See the World, in dem Rettberg untersucht, wie Technologien wie Überwachungskameras und TikTok-Filter unsere Wahrnehmung der Welt beeinflussen. In dem 2014 ebenfalls im Open-Access veröffentlichten Buch Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves untersucht Rettberg, wie Selfies, Blogs und Lifelogging-Geräte unsere Selbstwahrnehmung prägen und eine neue Art der Identitätsdarstellung ermöglichen.